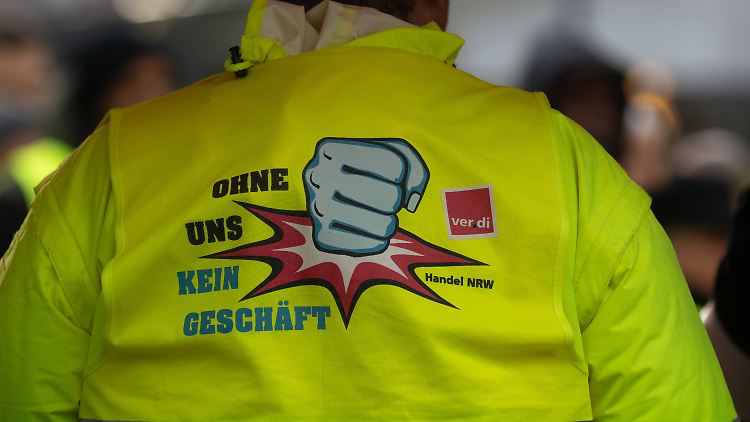Das Landgericht Berlin II hat Meta in sechs Urteilen wegen des Aufzeichnens von Nutzerspuren und damit verbundener Verstöße gegen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) zu vergleichsweise hohen Schadensersatzzahlungen von jeweils 2000 Euro an die Kläger verdonnert. Konkret geht es um den Einsatz der Meta Business Tools, die Nutzern als zentrale Plattform für die Verwaltung von Marketing- und Werbeaktivitäten auf Facebook und Instagram dienen. Der US-Konzern muss laut den Urteilen auch Auskunft geben über die mit diesen Instrumenten erhobenen personenbezogenen Daten sowie diese teils löschen oder anonymisieren.
Die Kläger machten laut der Berliner Justiz jeweils geltend, dass Meta alle digitalen Bewegungen auf Webseiten und mobilen Apps sämtlicher Mitglieder von Facebook und Instagram auslese und aufzeichne, wenn diese Angebote von Dritten die Meta Business Tools installiert hätten. Diese ermöglichten es, die gesammelten Daten mit einem einmal angelegten Nutzerkonto zu verbinden und so ein Profil über Personen anzulegen. Dieses könnte etwa besonders sensible Informationen wie ihre politische und religiöse Einstellung, ihre sexuelle Orientierung oder etwa Erkrankungen erfassen. Denn es sei damit möglich, etwa Angaben über Bestellungen bei Apotheken, Angaben zu problematischem Suchtverhalten oder die Nutzung des Wahl-O-Mat auszulesen. Es sei unklar, mit wem die Beklagte die so erstellten Profile teile.
Der Einsatz von Meta Business Tools auf Webseiten und Apps sei dabei nur eingeschränkt erkennbar, monierten die Kläger. Schätzungen zufolge seien die damit verknüpften Tracking-Funktionen bei mindestens 30 bis 40 Prozent der Websites weltweit und auf der überwiegenden Mehrzahl der meistbesuchten 100 Web-Angebote in Deutschland im Einsatz. Dies erfolge nicht nur ohne Einwilligung, sondern auch gegen den ausdrücklichen Willen der Betroffenen.
Keine Rechtsgrundlage für Datenverbeitung
Meta hielt dagegen, die Drittunternehmen seien für die Installation und Nutzung der Business Tools und somit für die Offenlegung der Daten verantwortlich. Der Konzern selbst nehme zumindest eine Datenverarbeitung für das Bereitstellen personalisierter Werbung nur vor, wenn die Nutzer ausdrücklich hierin einwilligten. Anderenfalls würden übermittelte Informationen nur begrenzt, etwa für Sicherheits- und Integritätszwecke genutzt.
Das Landgericht fand die Argumentation der Beklagten nicht schlüssig und gab den Klagen statt (Az.: 39 O 56/24 et al.). Es verurteilte Meta zum Befolgen der Betroffenenrechte nach der DSGVO. Die Kläger haben demnach etwa Anspruch auf Auskunft nach Artikel 15 der Verordnung, da die Beklagte die über die Meta Business Tools erhaltenen persönlichen Daten der Kläger zum Bilden von Persönlichkeitsprofilen verarbeitet und gespeichert habe. Der Löschungs- beziehungsweise Anonymisierungsanspruch bestehe nach Artikel 17 DSGVO, da für die Datenverarbeitung keine Rechtsgrundlage bestehe.
Meta: Kein Kommentar
Die Urteile vom 4. April sind noch nicht rechtskräftig. Beide Seiten können dagegen Berufung beim Kammergericht innerhalb eines Monats nach Zustellung der schriftlichen Urteilsgründe einlegen. Meta will die Begründung zunächst abwarten. Eine Sprecherin des Konzerns sagte heise online, die Sache derzeit nicht zu kommentieren.
Erst im Februar verurteilte auch das Landgericht Stuttgart Meta wegen illegitimer Datenernte über die Business-Tools-Suite. Dabei ging es vor allem um die Einbindung dieser Instrumente auf bild.de. Meta muss laut dieser Entscheidung dem Kläger aber nur 300 Euro Schadenersatz zuzüglich 227 Euro vorgerichtlicher Anwaltskosten zahlen. 90 Prozent der Verfahrenskosten haben die Stuttgarter Richter dem Erstreiter des damit teuren juristischen Siegs aufgebürdet.
Die Höhe von Schadenersatzzahlungen in DSGVO-Rechtsstreitigkeiten ist nicht pauschal festgelegt und hängt stark vom Einzelfall ab. Es gibt keine festen Beträge oder eine allgemeingültige Berechnungsgrundlage in der Verordnung selbst. Deutsche Gerichte haben Klägern in Fällen, in denen sie den nachzuweisenden immateriellen Schaden als gering einstuften, oft nur symbolische Beträge im Bereich von wenigen hundert Euro zugesprochen. Für schwerwiegendere Verstöße bewegen sich die Summen im Bereich von mehreren tausend Euro. Der Nachweis eines konkreten wirtschaftlichen Schadens ist laut dem Bundesgerichtshof nicht nötig.