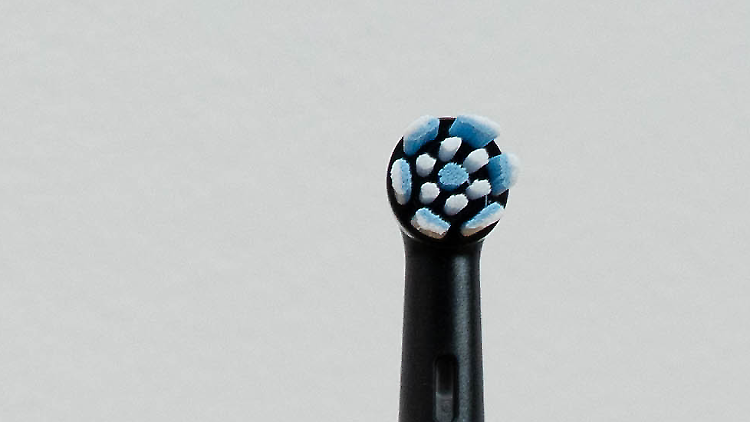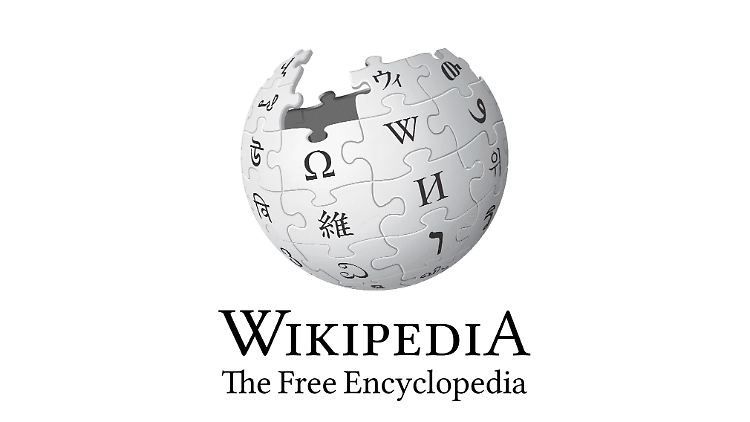Trump macht den Deal, den Rest macht Europa. So stellt sich der US-Präsident den Waffenstillstand für die Ukraine vor. Aber kann Europa Friedenstruppe - ohne die USA? Experten skizzieren, was auch auf Deutschland zukommen könnte. Ein Modell heißt "Bluffen und Beten".
Die Botschaft Donald Trumps ist klar: Der US-Präsident sieht sich gern dafür verantwortlich, mit dem russischen Machthaber Wladimir Putin einen Deal auszuhandeln, der die Kampfhandlungen an der Ukrainefront beendet. Was aber kommt danach? Als vor zehn Jahren das zweite Minsker Abkommen geschlossen wurde, schwiegen die Waffen für zwei Tage. Danach überrollten die Russen die nächste Donbass-Ortschaft, seit dem schwiegen die Waffen keinen Tag. Wie ließe sich das verhindern?
Not our business, heißt es aus dem Weißen Haus. Europa soll das machen, sagt Donald Trump. Auf keinen Fall Europa, sagt der Kreml. Stabil und günstig zur Absicherung gegen den russischen Aggressor wäre eine Eingliederung Kiews ins Nato-Bündnis. Doch Trump macht klar: Das steht nicht zur Debatte. Es muss eine Alternative her. Am Montag ließ Putin erstmals durchblicken, er könne eine Friedenstruppe mit europäischen Streitkräften womöglich doch akzeptieren. Nur: Kann Europa überhaupt Friedenstruppe - ohne die USA? Die wichtigsten Fragen und Antworten.
Wie sichert man die Waffenstillstandslinie?
Aus Sicht von Oberst Markus Reisner, Militärexperte im Österreichischen Bundesheer, stellen sich vor allem zwei Fragen: In welchem Raum soll die Truppe stehen und welches Mandat bekommt sie genau? Ein Mandat kann die reine Überwachung des Friedens beinhalten. Sprich: Die Soldaten würden selbst nicht schießen. Es kann aber auch bedeuten, Frieden durchzusetzen oder erst zu schaffen. Also womöglich selbst zu kämpfen. Je robuster ein Mandat ist, desto mehr Rechte haben die Soldaten. Bloß, wer könnte es stellen?
Ein robustes UN-Mandat käme nicht in Frage, denn Russland als Mitglied des UN-Sicherheitsrates würde dagegen sein Veto einlegen. Bei der Europäischen Union könnten Ungarn und die Slowakei ihr Vetorecht nutzen, ein Nato-Mandat haben die USA schon abgeräumt. Was bliebe, wäre eine "Koalition der Willigen", also ein loser Verbund von Engagierten, auf Einladung der Ukraine.
Wer könnte dazugehören? Deutschland, Großbritannien und Frankreich wären wohl gesetzt, hinzu kämen die baltischen sowie nordischen Staaten und Polen. Weitere Mitglieder willkommen. Robust müssten die Truppen dieser Willigen sein, denn Putins Aggression wäre nur eingedämmt. Falls Russland seine Angriffe diesmal wirklich einstellen sollte, dann nur aus pragmatischen Gründen. Nicht etwa, weil Putin seine Ansprüche aufgegeben hätte, die Ukraine zu kontrollieren und in seine Einflusszone zu bringen.
Die russische Kriegswirtschaft produziert mehr als auf dem Schlachtfeld verbraucht wird. Laut Analyse der Sicherheitsexperten Claudia Major und Aldo Kleemann baut Moskau seine Kampffähigkeit derzeit aus, "indem es in Aufwuchs, Aufbau und Modernisierung von Ausrüstung, Industrie und Personal investiert".
Entscheidend für das Abschreckungspotential der europäischen Truppe: Sie müsste ein umfassendes Lagebild generieren können. Eines, das alle Domänen umschließt - nicht nur die Lage am Boden, sondern auch Luft, See, Weltraum, Cyberspace. Und: Ziviles. Ab dem Moment, wenn sich etwa Deutschland mit boots on the ground an der Sicherung des Waffenstillstands beteiligte, würde der Sicherheitsexperte Rafael Loss mit einer Verstärkung hybrider Angriffe durch Russland rechnen. "Ähnlich den russischen Überwachungsversuchen, mit denen die deutschen Verbände in Litauen schon jetzt konfrontiert sind, wären auch europäische Truppen in der Ukraine im Visier solcher Angriffe."
Auch das zivile Leben könnte vermehrt zum Ziel werden. "Russland würde versuchen, Keile zwischen die Ukraine und ihre Unterstützer, aber auch zwischen die Europäer untereinander zu treiben. Ziel wäre es, die Verbündeten zu entzweien.
Das Lagebild müsste aber auch "in Führungs- und Kommandostrukturen bearbeitet und multinational geteilt werden können", sagt Reisner. Dazu müssten Systeme abhörsicher miteinander kommunizieren. Alles andere als trivial, wie deutsche Soldaten in der Vergangenheit mehrfach in Litauen feststellten: Auf ihren technisch veralteten Funkgeräten hörten sie statt der litauischen Übungspartner plötzlich Stimmen russisch sprechen.
Die Soldaten müssten in der Lage sein, sich gegen viele Bedrohungen zu schützen - Minen, Drohnen, indirekten, aber auch direkten Beschuss, sagt Reisner. "Zudem müssen eingesetzte Truppen aus geschützten Feldlagern heraus operieren und die Kontinuität durch Rotation gewährleisten." Alle vier bis sechs Monate würde man neue Soldaten über große Distanzen in die Ukraine transportieren. "Dies erfordert leistungsfähige Flug- oder Seehäfen."
Die Truppen müssten fähig sein zum Kampf der verbundenen Waffen - dem Zusammenspiel aller Domänen. Luftwaffe, Soldaten am Boden, Marine, Cyberspace, alles vernetzt. Das ist herausfordernd, aber sehr vorteilhaft. "Es wird viel über boots on the ground gesprochen", sagt Sicherheitsexperte Loss. Aber es können ja auch ships in the Black Sea oder aircrafts above Ukraine einen Beitrag leisten. Die Luft- oder Seestreitkräfte könnten die Schlagkraft einer Bodentruppe nochmal erhöhen, wenn zum Beispiel die Europäer im Schwarzen Meer bei Minenräumung und Verteidigung der Küste helfen würden. Die ukrainische Luftwaffe könnte mit europäischen Luftwaffen eng zusammenarbeiten.
Am Boden wiederum müsste in kurzer Zeit Infrastruktur aufgebaut werden, die eine große Zahl von Soldaten unterbringt. Die Friedenstruppe für den Kosovo Ende der 90er Jahre wuchs erst im Laufe der Zeit zu ihrer vollen Größe von 50.000 Kräften auf. Ebenso die Infrastruktur, die sie umgab. Strom? Trinkwasser? "Ich vermute, man müsste zumindest erwägen, dass auch diese kritischen Systeme zum Ziel russischer Hybridangriffe würden", sagt der Nato-Experte. Das könnte für autarke Systeme sprechen, aus der Heimat mitgebracht.
Zur Unterbringung sähe Loss, der beim European Council on Foreign Relations forscht, Containersammlungen als Mittel der schnellen Wahl, das sich dann über die Jahre entwickeln ließe. Das Bundeswehrkontingent, das im jordanischen Al Asrak als Teil einer Koalition der Willigen gegen den IS im Einsatz ist, hatte irgendwann sogar Europaletten-Möbel wie in der heimischen Clubszene im Gemeinschaftsbereich. Doch sowas dauert. "Man könnte nicht davon ausgehen, dass zum Start gleich 5000 Leute mit Material und Logistik über die Grenze marschieren", sagt Loss. "Es würde um einen Aufwuchs über die Zeit gehen."
Enge Absprachen zwischen den Armeen für Ausstattung, die sich am Bedarf orientiert - wünschenswert, aber nicht wahrscheinlich. "Die Europäer haben es in drei Jahren Krieg nicht geschafft, eine Produktion aufzustellen, die zum einen die Ukraine versorgt und zum anderen die Bereitschaft der eigenen Streitkräfte hebt - von teilweise desolatem Niveau auf einen Zustand, der annehmbar ist."
Und dann wäre da noch die Nulllinie, also die ehemalige Front, wo die Kriegshandlungen eingefroren würden. Die ließe sich aus Distanz beobachten, trotzdem hielte der Militärexperte Gustav Gressel eine militärische Präsenz für notwendig. "Wenn auch nicht so dicht, wie im Falle eines heißen Krieges".
Diese Aufgabe würde vermutlich den Ukrainern zufallen, doch Gressel sähe auch die europäischen Unterstützer "hin und wieder an die Nulllinie rotieren". Die Standorte für die europäischen Soldaten wären eher nicht in Frontnähe. Kontingente in Lviv oder Odessa wären denkbar.
Um wie viele Soldaten würde es gehen ?
Für den Kreml kämpfen etwa 600.000 Soldaten in der Ukraine, an einer Front, die sich über 900 Kilometer zieht. Die Rechnung ist einfach: Es kostet mehr Kraft, einen Gegner anzugreifen, als sich gegen einen Angriff zu verteidigen. In Militärkreisen gilt als notwendiges Kräfteverhältnis: 1 zu 3.
Demnach müsste die Ukraine die ehemalige Front mit etwa 200.000 Soldaten gegen erneute russische Angriffe sichern, um Putin glaubhaft abzuschrecken. Kleemann und Major von der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) berechnen die dafür nutzbaren ukrainischen Truppen und kommen auf "eine zusätzlich notwendige westliche ideale Kontingentstärke von etwa 150.000 Soldaten".
Wer noch präsent hat, wie die Bundeswehr seit einem knappen Jahr die 4800 Soldatinnen und Soldaten samt Ausstattung für die ständige Brigade in Litauen "ausschwitzt" (Zitat Heeresinspekteur Alfons Mais), der kommt spontan zur Einschätzung: 150.000 Kräfte aus europäischen Armeen? Völlig utopisch. Und liegt damit richtig. Zumal diese Kräfte ständig einsatzbereit wären und darum, wie auch Reisner sagt, rotieren müssten. Ein Kontingent ist im Einsatz, eins regeneriert sich vom letzten Einsatz, eins bereitet sich auf den nächsten Einsatz vor. Macht 150.000 mal drei.
Aber auch ohne Rotation erachten Major und Kleemann eine solche Größenordnung in ihrem Papier als "illusorisch". Die Armeen der Europäer sind schlicht nicht groß genug, um eine solche Zahl aufzubringen. Die Streitkräfte vieler Ukraine-Unterstützer sind in die Verteidigungspläne der NATO eingebunden. Würden sie große Teile ihrer Armee in die Ukraine verschieben, wäre der Schutz des Bündnisgebietes geschwächt zu Zeiten, in denen Putin Blut geleckt hat. "Indem die Nato-Europäer Truppen in die Ukraine bewegen, würden sie die gesamte Ostflanke freimachen", sagt Loss. Das kann nicht Sinn der Sache sein.
Was also wäre eine realistische Größe?
Die Unterstützer könnten der Ukraine Hilfe zur Selbsthilfe leisten: Mit der dortigen Rüstungsindustrie kooperieren, Produktion finanzieren, in kritischen Fähigkeitsbereichen unterstützen. Major und Kleemann halten eine Truppe von 10.000 oder 20.000 bis allerhöchstens 40.000 Soldatinnen und Soldaten für machbar. Diese könnten in der Ukraine als Teil der dortigen Landstreitkräfte Unterstützungsarbeit leisten. An westlichen Waffen vor Ort ausbilden, mit den Ukrainern gemeinsam trainieren, Material instandhalten, strategisch beraten.
Doch Vorsicht ist aus Sicht der Forscher geboten: Denn die Abschreckung mit deutlich weniger Kräften als nötig wären, um einen russischen Angriff sicher abzuwehren, würde den Kreml vielleicht nicht überzeugen. "Russland könnte sie zeitnah testen und den Krieg fortsetzen", schreiben die Wissenschaftler. "Bluffen und Beten" haben sie dieses Modell genannt.
Ginge es überhaupt ohne die USA?
Die USA würden an wichtigen Schnittstellen fehlen. Denn sie halten Fähigkeiten vor, die in Europa schlicht keiner hat: vor allem bei der Aufklärung, für schweren Lufttransport, aber auch auf Kommandoebene. "In Europa fehlt die Erfahrung damit, tatsächlich Großverbände zu organisieren und zu führen", sagt Loss. "Diese Funktion, alle zu integrieren, können in dem Umfang nur US-Stabsoffiziere leisten." Bleibt Trump draußen, dann fehlt dieses Knowhow.
Major und Kleemann fassen das so zusammen: "Ohne einen Rückgriff auf US-Fähigkeiten wie strategischen Lufttransport, Logistik und Aufklärung ist eine glaubwürdige Abschreckung unvorstellbar."
Zumindest eine indirekte Beteiligung der USA hielte auch Loss für dringend notwendig, er sähe aber auch Chancen dafür. "Man könnte das in die Äußerungen des US-Verteidigungsministers Pete Hegseth hineinlesen, der ja nur direkte amerikanische Beteiligung ausschloss." Durch diese Hintertür könnten Bereiche wie Führung, Aufklärung und Logistik zum Teil auch aus der Distanz amerikanisch unterstützt werden.
In jedem Fall warnt der Sicherheitsexperte davor, die Bedeutung einer Absicherung der Ukraine zu unterschätzen und die Sache mit zu wenig Engagement und Kraft anzugehen. "Bluffen und Beten" - das kann man versuchen. Muss man vielleicht. "Eine Preisgabe der Ukraine an Russland würde das Risiko eines neuen Krieges in Europa ebenso erhöhen, wie eine unzureichende westliche Absicherung", schreiben Major und Kleemann. Würde Putin sie austesten, den Westen vorführen, und die USA kämen nicht zu Hilfe - wäre der Verlust an Glaubwürdigkeit nur schwer zu ermessen. Und wenn Putin nicht mehr glaubt, dass der Westen sich wehren könnte ….