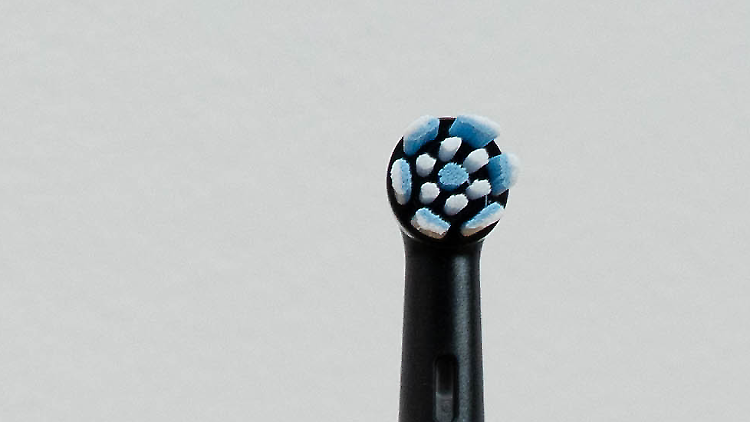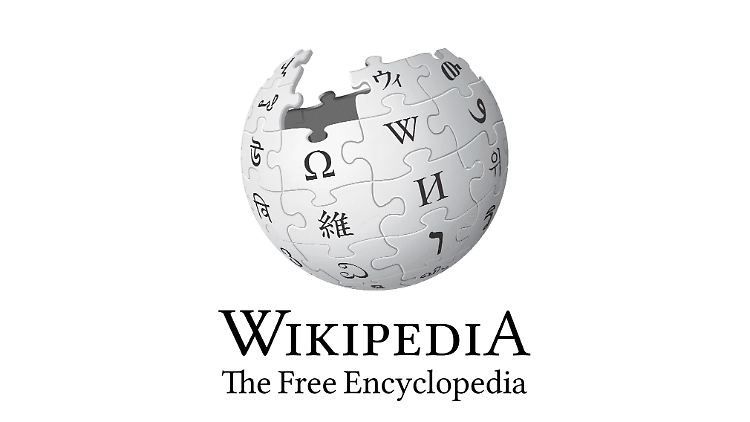Bei den Demokraten herrscht Unmut und Uneinigkeit hinsichtlich des Umgangs mit Donald Trump. Gleichzeitig blickt die Partei voraus auf die nächsten Wahlen. Und da könnte sie in der Zukunft ein sehr großes Problem erwarten.
Für die Demokraten waren die Wahlen im November eine Niederlage auf ganzer Linie. Das Weiße Haus geht an Trump, die Mehrheit im Senat ist perdue, und im Repräsentantenhaus halten die Republikaner knapp ihre Vormachtstellung. Und die Demokraten tauchen anschließend ab, fallen in ein Loch.
Und aus dem haben sie sich bis jetzt nicht wirklich befreien können. Trump ist dagegen allgegenwärtig mit seinem Dauerfeuer aus politischen Vorstößen und Executive Orders. Die Demokraten haben dem nichts entgegenzusetzen.
Im Kongress haben sie nur wenig Handlungsmöglichkeiten, können die Ernennung von fragwürdigen Ministern im Senat nicht blockieren, geschweige denn Gesetzesinitiativen aufhalten. Und eine der wenigen Chancen geben sie aus der Hand. Während die Demokraten im Repräsentantenhaus sich gegen ein Übergangsgesetz zum Haushalt wehren, kippen Senats-Minderheitsführer Chuck Schumer und neun weitere Demokraten im Senat um, verschaffen den Republikanern die notwendigen Stimmen - und kriegen dafür lobende Worte von Trump.
Aus der Basis hagelt es Kritik an Schumer, aber auch die Abgeordneten untereinander sind uneins. Linke Herausforderer laufen sich bereits für die Vorwahlen für die Wahl 2026 warm und möchten langjährige Abgeordnete ablösen - und einen radikaleren Kurs gegen Trump fahren.
Entwicklung der Demografie schwierig für Demokraten
Allerdings steht die Partei wohl noch vor einem deutlichen größeren Problem. Und das langfristig. Die Entwicklung der Demografie in den USA dürfte demokratische Hochburgen schwächen, wie Kolumnist Ezra Klein in der "New York Times" ausführt. Eine tickende Zeitbombe.
Die demokratischen Bundesstaaten schrumpfen jetzt bereits. Kalifornien verliert im Jahr 2023 268.000 Einwohner, Illinois 93.000 und New York 179.000. Sollte der Trend anhalten, droht ein böses Erwachen, spätestens mit den ersten Wahlen nach dem Zensus 2030. Wer Bürger verliert, verliert Macht. So will es das politische System in den USA.
Die tendenziell liberal wählenden Bundesstaaten würden an Einfluss verlieren, republikanische Hochburgen profitieren. Die Anzahl an Wahlleuten, die aus den liberalen Staaten ins Electoral College entsendet werden dürften, würde sinken. Und in diesem Gremium muss man als Kandidat schlussendlich die magischen 270 Stimmen auf sich vereinen, um die Präsidentschaftswahl zu gewinnen.
So könnten die Staaten, die Kamala Harris im November gewann, im Electoral College zukünftig insgesamt zwölf Sitze an Trump-Staaten verlieren. In diesem Szenario müssten die Demokraten plötzlich deutlich mehr Staaten gewinnen, um das Weiße Haus zu erobern. Mit dieser angenommenen Zusammensetzung des Electoral College könnte ein Demokrat dann jeden Staat gewinnen, der im November an Bidens-Vize ging sowie Michigan, Pennsylvania und Wisconsin - und würde dennoch als Verlierer in der Election Night dastehen.
Schwere Zwischenwahlen 2026
Auch im Repräsentantenhaus würden sich schwindende Einwohnerzahlen bemerkbar machen. Das Brennan Center for Justice prognostiziert mit dem Zensus in fünf Jahren einen Verlust von vier Sitzen in Kalifornien. Aber auch New York, Illinois oder Minnesota wären betroffen. Große Gewinner dagegen: Texas und Florida. Beide Staaten könnten jeweils vier Sitze im Repräsentantenhaus hinzugewinnen. Entwicklungen, die es komplizierter gestalten würden, eine Mehrheit in der Kongresskammer zusammenzuzimmern.
Doch eine zerstrittene Partei wird es auch jetzt schon schwer haben gegen Trump und seine Gefolgsleute. Denn auch die kurzfristigen Perspektiven sind für die Partei der Ex-Präsidenten Joe Biden und Barack Obama eher düster. In Umfragen sieht es für die Demokraten derzeit katastrophal aus. In einer Erhebung von CNN erreichen sie noch Zustimmungswerte von 29 Prozent. Der tiefste Wert seit 1992. Und auch bei jungen Wählern - speziell bei Männern - schneiden die Demokraten historisch schlecht ab, der Trend bei Latinos geht auch in Richtung Republikaner.
Die Zwischenzahlen 2026 stellen die Demokraten damit bereits vor Herausforderungen. Die Karte der zur Wahl stehenden Sitze im Senat ist aus ihrer Sicht wenig vorteilhaft. Es gibt bei den 35 zur Wahl stehenden Senatssitzen nur wenige Rennen, die Chancen bieten, die verloren gegangene Mehrheit zurückzuerobern oder sich einem Patt zumindest anzunähern.
Vielmehr sind möglicherweise weitere demokratische Senatssitze, wie im Swing State Georgia, in Gefahr. Das Center for Politics der University of Virgina hält für 2026 fest: "Die Sitze sind einfach nicht da." Die Demokraten müssten dafür schon wieder Richtung 2028 schauen.