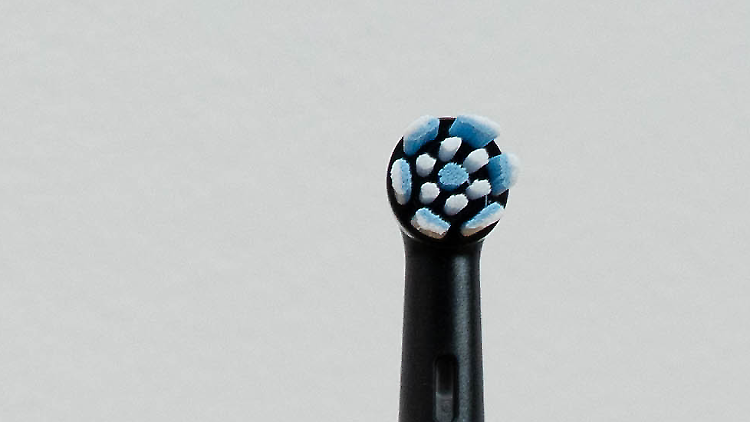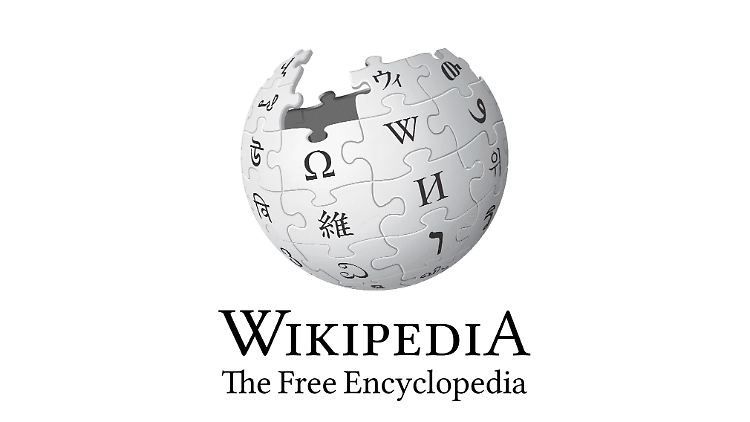Der Politologe Herfried Münkler erwartet zeitnah fundamentale Entscheidungen über die deutsche Beteiligung an Atomwaffen. Er erkennt in Europa eine der fünf globalen Mächte, die um Einfluss ringen. Präsident Trump und sein Team hätten keine strategischen Vorstellungen und handelten in den Tag hinein: "Sie werden damit auf die Nase fallen."
ntv.de: Herr Münkler, Europa muss sich durch eine Welt zunehmender geopolitischer Spannungen manövrieren. Wer stellt aus Ihrer Sicht gerade die größte Bedrohung dar - der russische Präsident Wladimir Putin oder sein US-Amtskollege Donald Trump? Oder übersehen wir gerade Chinas Staatschef Xi Jinping?
Herfried Münkler: Wenn man im Augenblick denkt, dann ist Trump derjenige, der die meiste und größte Unruhe erzeugt. Wenn man das in längerfristigen Strukturen betrachtet, sind wohl Xi Jinping und Wladimir Putin mitzudenken. Diese drei haben es auf die EU abgesehen. Sei es, sie zu zerlegen oder ein bisschen zu zerpflücken. In geopolitischer Hinsicht sind die Europäer zurzeit in einer Sandwichposition. Das ist das Schreckensszenario der Geopolitik. Auf der einen Seite wird Europa durch Putin bedrängt, bedroht, eingeschüchtert. Auf der anderen Seite wird Europa durch Trump ebenfalls verängstigt durch die Drohung, den amerikanischen Schutzschirm über Europa einzuklappen oder so löchrig zu machen, dass er nicht mehr das leistet, was er zu leisten hat.
Wenn wir auf die USA blicken: Ein fast ikonisches Bild der Amtseinführung ist Trump und in der Reihe dahinter nahezu alle Tech-Milliardäre, die die Branche derzeit dominieren. Wie gefährlich kann diese Allianz werden, auch für die Europäer?
Sie ist im Augenblick schon gefährlich, weil Elon Musk von Trump den Auftrag hat, den Regierungsapparat der USA vielleicht nicht zu zerschlagen, aber so zu verkleinern, dass er nicht mehr das leisten kann, was er früher geleistet hat. Bei Trump tritt das Regieren mit Tweets an die Stelle des demokratischen Rechtsstaats, der Leitplanken hat, die dem Können und Dürfen in einer Demokratie Grenzen aufzeigen. Die Rechtsstaatlichkeit und die Verfassung schreiben eigentlich vor, dass wir bestimmte Sachen nicht machen können, selbst wenn wir das mit Mehrheit so wollen. Trump hat jedoch die Vorstellung, unmittelbar zu regieren. Er akzeptiert keine Zwischeninstanzen, die vermitteln, was die Vorstellungen der Spitze bis hinunter in die jeweiligen Gemeinden sind. Ihm kommen die Tech-Milliardäre, die Inhaber von Plattformen sind, zupass. Die Amtseinführung Trumps war ein Blick auf das neue Ensemble der Macht.
Denken Sie, dass die Demokratie der USA dies überleben wird, oder wird dort womöglich eine Oligarchie entstehen?
Das ist die Frage. Wir beobachten eine Auseinandersetzung zwischen Trump, der auf der Grundlage der imperialen Befugnisse des Präsidenten mit Dekreten regiert, also letzten Endes am Parlament vorbei. Sein Gegenspieler ist die Justiz, die immer wieder Dekrete aufhebt. Inwieweit Trump sich zutraut, weiter an den Entscheidungen der Gerichte vorbeizuregieren, wie zuletzt bei bestimmten Abschiebungen, muss man sehen. Sicherlich ist die zweite Präsidentschaft Trumps in höherem Maße als die erste darauf aus, den demokratischen Rechtsstaat als Limitierung des Wollens des mächtigen Mannes an der Spitze zu zerschlagen.
Müsste Trump den Polizeiapparat unter Kontrolle bringen, um an den Gerichten vorbei durchzuziehen, was ihm eigentlich verboten wird?
Vielleicht nicht den ganzen Polizeiapparat, aber Teile. Wobei anzunehmen ist, dass Teile ihm in einer Reihe von Fragen nahestehen, weil sie in ihren Möglichkeiten des Zugriffs durch den Rechtsstaat auch behindert werden. Da gibt es ein großes Narrativ: Die Polizei könnte besser handeln, wenn sie nicht durch Institutionen, vor allen Dingen durch Gerichte, daran gehindert würde, es zu tun. Das ist aber eine Machtfrage, wer über welches Instrument der Macht verfügt und wie verlässlich. Man kann schwer voraussagen, wie das ausgeht. Aber Trump hat im Vorfeld schon eine Reihe von Offizieren des Militärs abgelöst, um sie durch Leute seines persönlichen Vertrauens zu ersetzen. Trump richtet sich darauf aus, die Institutionen in die Hand zu bekommen.
Wo liegen für die Europäer die Gefahren in dem, was Trump da tut?
Ich würde sagen, in seiner Unberechenbarkeit. Wenn bei Trump etwas gewiss ist, dann, dass ungewiss ist, was er am nächsten Tag tun wird. Ob er das, was er am Tag zuvor mit ungeheurer Pose in die Welt gesetzt hat, wieder zurücknimmt. Er schreibt ja gern mit einem dicken Filzstift seine Dekrete und zeigt sie dann. Am nächsten Tag hebt er sie wieder auf. Wir haben das beobachtet in der Frage der Zölle gegen Mexiko und Kanada. Das ist eine unangenehme Situation für die Europäer, weil sie nicht genau wissen: Sollen sie ihn eher besänftigen, indem sie ihn nicht provozieren? Oder wäre es richtig, ihm entschlossen entgegenzutreten?
Lässt sich der Umgang mit Trump überhaupt auf eine Generalstrategie vereinen?
Da sind auch die Aussagen von Trump-Kennern widersprüchlich. Die einen sagen: Er hasst nichts mehr als Leute, die schwach und demütig sind. Und er hat Respekt vor Leuten, die ihm breitschultrig und entschlossen gegenübertreten. Das würde etwa heißen, dass die Europäer energisch mit ihm umgehen sollten und sagen sollten: Okay, wir bestellen die amerikanischen Kampfflugzeuge wieder ab.
Sie sprechen von den 35 Jets des Typs F-35, die Deutschland vor nicht allzu langer Zeit durch das Sondervermögen finanziert bei einem US-Rüstungskonzern bestellt hat.
Andere sagen wiederum, man muss ihn umschmeicheln und streicheln. Trump hat zwei Seiten. Man kann nie vorhersehen, welche er zeigen wird, welche Seite an diesem Tag gegenüber einem Besucher im Oval Office die entscheidende ist. Emmanuel Macron und Keir Starmer haben als französischer Präsident und britischer Premier versucht, mit freundlichen Methoden auf ihn Einfluss zu nehmen. Aber man kann nicht sagen, dass das in irgendeiner Weise Folgen gezeitigt hätte.
Politische Berater, die Trump nahestanden, beschreiben die Hürden, wenn man mit ihm versucht über Geopolitik zu sprechen. Er höre nach zwei Minuten nicht mehr zu. Hat er tatsächlich keinen Plan? Oder haben andere, Leute wie J.D. Vance, den Plan und schicken Trump als Bulldozer vor?
Vielleicht kann man das in Bezug auf die Beziehung von Trump zu seinem Vizepräsidenten Vance so sagen. Trump ist nur an Deals interessiert. Die geopolitischen Fragen interessieren ihn nicht wirklich. Es gibt zwei Möglichkeiten: Entweder er begreift sie nicht. Oder er begreift sie sehr wohl, aber spürt auch, dass Strategie eine Einschränkung seiner Handlungsmöglichkeit im Hinblick auf das Deal-Making darstellt. Das heißt, Trump handelt im Prinzip aus der Laune heraus. Man könnte auch sagen: gelegenheitsbezogen, opportunistisch und Konstellationen ausnutzend.
Was bei aller Erratik sichtbar ist: Trump biedert sich bei Putin an, um Russland aus dem Block mit China herauszubrechen. Wie schwierig wird das?
Vance und vor allen Dingen US-Außenminister Marco Rubio verfolgen eine Strategie, die darauf hinausläuft, so etwas ähnliches hinzubekommen wie Henry Kissinger als US-Sicherheitsberater Anfang der 70er-Jahre. Kissinger hat sich damals bemüht, China aus der Nähe zur Sowjetunion herauszuholen und als einen Akteur zu platzieren, der zwischen Sowjetunion und dem Westen steht. Jetzt versuchen Vance und Rubio, Russland aus der engen Bindung an China herauszuholen, weil China für die Vereinigten Staaten die Hauptherausforderung der hegemonialen Position der USA ist. Aber die USA werden dadurch die Europäer verlieren, denn die werden Kontakte zu China intensivieren, um eine Gegenkoalition zu bilden.
Zu China?
Die Wertebindung zwischen den Europäern und den USA ist nicht mehr so, wie sie früher war, als sie eine weitere Annäherung an China verhindert hat. Das Ganze wird ein politisches Spiel zwischen den fünf Mächten USA, China, Europa, Russland und Indien. Dieses Spiel wird nicht mehr in einer regelbasierten, sondern in einer machtbasierten Ordnung ablaufen.
Hätten die USA überhaupt Nachteile, wenn sie die Europäer verlieren?
Ohne die Europäer stehen die Amerikaner plötzlich nicht mehr so stark da, wie sie glauben, sein zu müssen. Ob eine Auseinandersetzung wirtschaftlicher Art mit China dann noch zu gewinnen wäre? Ich denke, ohne die Europäer können sie die nicht gewinnen. Und mit den Russen können sie auch wirtschaftlich keinen großen Stich machen. Die Russen werden die USA sowieso hereinlegen. Die Russen werden die enge Bindung an China nicht aufgeben. In Trumps Regierung versammeln sich Leute, die kurzfristig denken, die keine langfristigen Vorstellungen haben, vor allen Dingen keine strategischen Vorstellungen. Sie wissen nicht, was es heißt, reagieren zu können auf einen Akteur, der einen eigenen Willen hat und eigene Karten und eigene Figuren auf dem großen Schachbrett der Politik. Sie agieren auf unterschiedliche Weise aus dem Tag heraus und in den Tag hinein. Die Leute in Trumps Regierung werden damit auf die Nase fallen.
Wenn Europa tatsächlich mit China punktuell zusammenarbeitet - gibt es da nicht auch wieder Risiken, gerade für die Demokratie?
Natürlich. Wenn man diese fünf Mächte nimmt, die ich aufgeführt habe, dann behaupten die Inder zwar von sich, sie seien die größte Demokratie der Welt. Aber diese Demokratie ist geprägt durch einen aggressiven Hindunationalismus von Ministerpräsident Narendra Modi. Unter diesen fünf Mächten ist Europa, wenn auch nicht durchweg alle europäischen Staaten, der Hort des demokratischen Rechtsstaats. Die Europäer müssen wissen: Es ist keine Liebesheirat, wenn man mit einer dieser vier anderen Mächte zeitlich und sachlich begrenzte Koalitionen eingeht. Die Zusammenarbeit ist limitiert auf bestimmte Interessen, die für einige Zeit gemeinsam bestehen können. Die Europäer werden sich mit den USA und den anderen Mächten eher ad hoc in den einen Fragen verbünden und in den anderen nicht.
Damit sie den anderen Mächten selbstbewusster entgegentreten können, müssten die Europäer ihre Verteidigung eigenständig organisieren. Wer könnte da die Führungsrolle spielen?
Die mögliche neue Struktur zeigt sich bereits. Immer wieder treffen sich die Außen- und Verteidigungsminister des Weimarer Dreiecks - Frankreich, Deutschland, Polen - plus Italien. Vielleicht könnten die Spanier dazukommen und vor allem die Briten als Nato-Mitglieder, die zwar nicht mehr in der EU sind, sich ihr aber wieder annähern. Das wären Mächte, die künftig die Außen- und Sicherheitspolitik Europas an sich ziehen, sei das auf Nato- oder EU-Ebene. Sie können andere Länder einladen, mitzumachen, müssen aber nach dem Mehrheitsprinzip entscheiden. Das ist das Problem der Europäischen Union: In zentralen Fragen wird durch Einstimmigkeit entschieden. Jeder Staat hat ein Vetorecht. Sowohl in der Europäischen Union als auch in der Nato muss künftig also mehrheitlich statt einstimmig entschieden werden. Anschließend sollten sich die führenden europäischen Mächte einigen, wer von ihnen den Oberkommandierenden in der Nato stellt. Es sollte kein US-Kommandierender mehr sein. In einem rotierenden System sollten sich die europäischen Länder abwechseln.
Es gibt allerdings gute Gründe für einen US-Oberkommandierenden in der Nato.
Das ist ein altes Problem der Europäer untereinander: Ihre Eifersucht, die historischen Erinnerungen und Traumata haben bislang nahegelegt, diesen wichtigen Nato-Posten per Outsourcing an die USA zu vergeben, damit ihn keiner dieser alten rivalisierenden Mächte bekommt. Wenn sie das überwinden und sich auf einen europäischen Oberkommandierenden einigen, sind andere Entscheidungen relativ einfach.
Was brauchen die Europäer darüber hinaus, um wehrhaft zu werden?
Es muss zu einer Europäisierung der nuklearen Abschreckungskomponente kommen. Das ist mehr als Macrons Angebot, dass die Deutschen unter den französischen Schutzschirm schlüpfen können. Die Europäer brauchen eine Abschreckung, die auch die baltischen Republiken, Polen oder Rumänien umfasst. Sie muss auch viel differenzierter sein als das, was die französische Force de Frappe oder das britische Militär zurzeit haben. Frankreich und Großbritannien haben bereits strategische Atomwaffen. Sie brauchen aber mehr taktische Atomwaffen, um die Palette der Nuklearwaffen zu vervollständigen.
Frankreich und Großbritannien haben bislang auf taktische Atomwaffen weitgehend verzichtet. Warum würden die aus Ihrer Sicht nötig?
Taktische Atomwaffen werden auf dem Gefechtsfeld eingesetzt, um Vorstöße zu blockieren, weil das Gelände nach einem Angriff unbegehbar ist. Strategische Waffen hingegen werden gegen ganze Städte, also hochgradig verwundbare, aber unverzichtbare Räume des Gegners eingesetzt. Wenn wir uns vorstellen, Putin würde einen Krieg mit Estland eröffnen, weil es dort eine große russische Minderheit gibt, kann man ihn nicht mit strategischen Atomwaffen abschrecken.
Warum nicht?
Weil es sehr unwahrscheinlich ist, dass die Europäer strategische Atomwaffen gegen Moskau oder Sankt Petersburg einsetzen würden, um Estland zu schützen. Denn bei einem Nuklearschlag gegen Moskau würden die Russen in einem Gegenschlag etwa Paris oder Berlin auslöschen. In einem solchen Szenario braucht man kleinere, taktische Atomwaffen. Das heißt nicht, dass die eingesetzt werden müssen. Aber sie könnten theoretisch auf dem Gefechtsfeld eingesetzt werden und dienen damit der glaubhaften Abschreckung im Nuklear-Schach.
Ist Deutschland bereit für eine Debatte?
Bei Schreckensszenarien mit Hunderttausenden Toten, wie ich sie gerade beschrieben habe, gibt es die Neigung zu sagen: Ich mache die Augen zu, ich halte die Ohren zu und verschließe auch meinen Geruchssinn, um gar nichts davon mitzubekommen. In der deutschen Politik wurde immer wieder das Ziel ausgegeben: Wir schaffen die Atomwaffen ab. Aber wir sind jetzt in einer anderen Welt. Wir werden eine nukleare Aufrüstung allenthalben beobachten. Auch die Russen wissen, was sie an ihren Atomwaffen haben. Das ist die eigentliche Ressource ihrer Macht. Man kann sich gar nicht vorstellen, dass die Russen in irgendeiner Weise darüber nachdenken würden, das abzugeben.
Welche Rolle könnte Deutschland bei dem Aufbau eines europäischen Atomschutzschirms übernehmen?
In die nukleare Abschreckungskomponente muss viel Geld hineingesteckt werden. Da kommen die Deutschen ins Spiel, weil sie die finanziellen Mittel aufbringen können, die Frankreich nicht hat, da es bis zum Halse verschuldet ist. Die Briten stehen finanziell nicht viel besser da als die Franzosen. Momentan schaut Deutschland bei diesen Diskussionen noch vom Rand aus zu. Zum einen hat das mit der Übergabe des Staffelholzes in der Regierung zu tun. Zum anderen ist das die Konsequenz daraus, dass es gerade die Deutschen waren, die mit den USA als sicherheitspolitische Schutzmacht aufs falsche Pferd gesetzt haben.
Dieser Fehler rächt sich jetzt?
Wann immer Macron stärker eine Europäisierung militärischer Fähigkeiten und der Rüstungsindustrie gefordert hat, zeigte ihm Berlin die kalte Schulter. Die Deutschen dachten, sie gäben den Amerikanern damit ein Zeichen, sich aus Europa zurückzuziehen. Und sie wollten die USA als Schutzmacht in Europa halten. Das hat dazu beigetragen, dass Europas Musik im Augenblick in Paris und London gespielt wird. Europa braucht eine glaubwürdige politische Spitze. Man wird das alles nicht ohne die Deutschen machen können. Die deutsche Politik muss aber eine Kehrtwende vollziehen. Der Vizechef des russischen Sicherheitsrats, Dmitrij Medwedew, hat durch sein nukleares Säbelrasseln im Kreml die deutsche Politik ein ums andere Mal dazu gebracht, rückwärtszugehen. Berlin schreckte zurück und kalibrierte die eigenen Vorstellungen so, dass sie mit den Erwartungen des Kremls kompatibel waren. Das ist auf Dauer keine Lösung.
Mit Herfried Münkler sprachen Frauke Niemeyer und Lea Verstl. Das Gespräch wurde zur besseren Verständlichkeit gekürzt und geglättet. Vollständig können Sie es im ntv-Podcast "Wieder was gelernt" anhören.