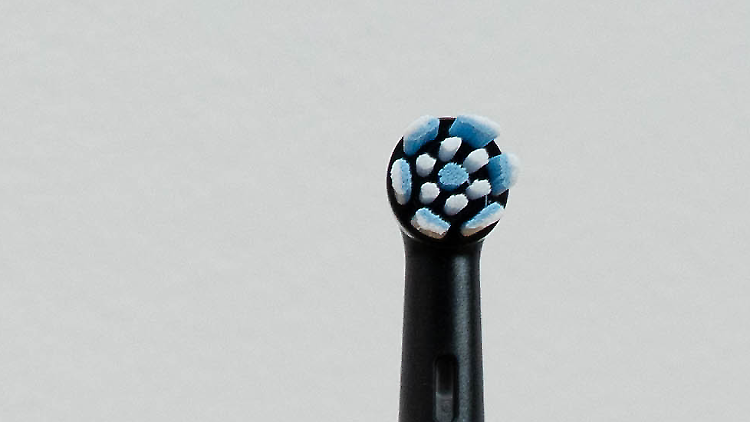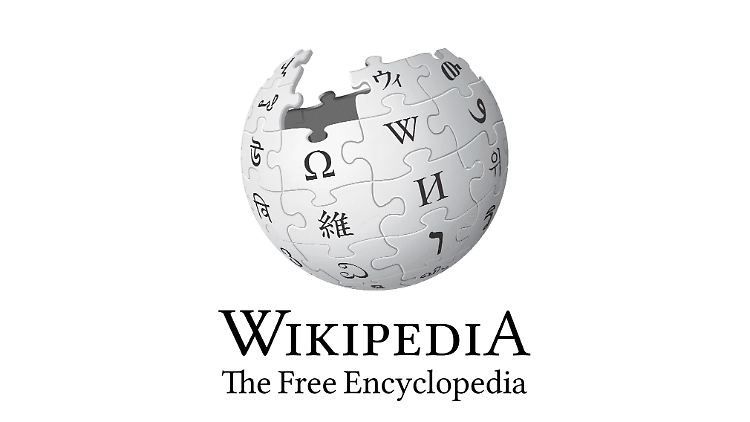In den Ukraine-Krieg kommt politische Bewegung. Während die USA zunächst jegliche Militärhilfe streichen, um den Druck auf Kiew zu erhöhen, arbeitet Europa unter Führung von Frankreich und Großbritannien an einer "Koalition der Willigen". Wie könnte eine Friedenstruppe aussehen?
Donald Trump und J.D. Vance wollen der Ukraine einen wirtschaftlichen Schutzschirm geben, keinen militärischen. Die neue US-Regierung hält das geplante Rohstoff-Abkommen für die bestmögliche Sicherheitsgarantie der Ukraine. Graben erst einmal amerikanische Unternehmen die Bodenschätze des Landes ab, werde Kiew vor russischen Angriffen geschützt sein, argumentieren der US-Präsident und sein Vize.
"Das ist eine viel bessere Sicherheitsgarantie als 20.000 Truppen aus irgendeinem Land, das seit 30 oder 40 Jahren keinen Krieg mehr geführt hat", sagt J.D. Vance bei Fox News. "Wenn man echte Sicherheitsgarantien will, wenn man wirklich sicherstellen will, dass Wladimir Putin nicht wieder in die Ukraine einmarschiert, dann ist die beste Sicherheitsgarantie, den Amerikanern wirtschaftliche Vorteile in der Zukunft der Ukraine zu verschaffen."
Die USA sind nicht bereit, der Ukraine militärische Sicherheitsgarantien zu geben. Dafür sollen die Europäer bitteschön selbst aufkommen, fordert Washington. Großbritannien und Frankreich haben den ersten Schritt notgedrungen gemacht. Unter Führung der beiden Länder arbeitet Europa an einem Plan für eine Friedensmission. Der britische Premierminister Keir Starmer und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron haben einen vierwöchigen Waffenstillstand vorgeschlagen. Dieser soll Raum und Zeit für Diplomatie schaffen - und für die Bildung einer europäischen Friedenstruppe.
Kein Mandat von UN, EU oder Nato in Sicht
Wie eine solche Mission aussehen könnte, ist derzeit unklar. "Das Mandat bestimmt, welche Rechte die eingesetzten Truppen haben, also beispielsweise eine reine Friedensüberwachung, eine Friedensdurchsetzung oder eine Friedensschaffung", schreibt Oberst Markus Reisner vom Österreichischen Bundesheer.
Grundsätzlich ist es kompliziert, ein Mandat für Friedenstruppen in der Ukraine zu erhalten, wie auch immer es aussieht. Eine Mission unter dem Dach der Vereinten Nationen ist jedenfalls ausgeschlossen, weil Russland einen Einsatz von Blauhelmsoldaten im UN-Sicherheitsrat blockieren würde.
Innerhalb der Europäischen Union und der Nato sieht es genauso düster aus, weil sich die Mitgliedstaaten einstimmig für einen solchen Einsatz aussprechen müssten. Von einer gemeinsamen Linie unter den europäischen Staaten könne jedoch keine Rede sein, sagt Sicherheitsexperte Rafael Loss vom European Council on Foreign Relations im Interview mit ntv.de. Vor allem Ungarn und die Slowakei dürften kein Interesse an einer Militäroperation in der Ukraine haben.
Verfassungsrechtliche Frage in Deutschland
Das einzig realistische Szenario für ein Friedenstruppen-Mandat ist deshalb die Bildung einer "Koalition der Willigen", wie es von Macron und Starmer vorangetrieben wird. "Ein Teil der Hoffnung ist, dass Russland durch die Präsenz europäischer Truppen, auch mit nuklearer Abschreckung im Falle von Frankreich und Großbritannien, ein bisschen beeindruckt sein würde", sagt Loss.
Für Deutschland stelle sich in diesem Zusammenhang allerdings eine verfassungsrechtliche Frage, gibt Loss zu bedenken. "Eigentlich müssen alle Auslandsmissionen der Bundeswehr von einem Mechanismus kollektiver Sicherheit mandatiert sein", sagt der Sicherheitsexperte. "Deutschland wird sich überlegen müssen, wie man sich daran beteiligen oder ob es in der EU einen Kompromiss geben kann, der dazu führt, dass die EU sozusagen eine 'Koalition der Willigen' damit beauftragt, militärische Maßnahmen durchzuführen. Organisatorisch wäre es jedenfalls sinnvoll, das unter einem Kommando zu machen."
Grundsätzlich dürften einer "Koalition der Willigen" die meisten europäischen Staaten nicht abgeneigt sein, neben Großbritannien und Frankreich könnten allen voran Deutschland, Italien, Polen sowie die baltischen und skandinavischen Staaten mitwirken. Fraglich bleibt jedoch, um wie viele Soldaten es überhaupt gehen würde.
"Vor allem die Faktoren Raum und Mandat sind ausschlaggebend für den endgültigen Kräfteumfang", macht Oberst Reisner vom Österreichischen Bundesheer deutlich. "So ist es beispielsweise aus Sicht des Kräfteaufwands günstiger, mit militärischen Kräften entlang einer Wasserlinie wie dem Dnepr präsent zu sein, als in urbanem oder bewaldetem Gebiet wie in Wowtschansk oder bei Lyman", schreibt Reisner.
200.000 Soldaten für Frontsicherung nötig
Militärexperten nennen ein Kräfteverhältnis von 1 zu 3, um sich robust gegen Angreifer verteidigen zu können. Es kostet mehr Kraft, einen Gegner anzugreifen, als sich zu verteidigen. Für Russland sind etwa 600.000 Soldaten in der Ukraine im Einsatz. Das heißt, es bräuchte ungefähr 200.000 Soldaten, um die Front gegen erneute russische Angriffe zu sichern und Putin glaubhaft abzuschrecken. Laut einer Analyse der Sicherheitsexperten Claudia Major und Aldo Kleemann von der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) bräuchte es unter Hinzuziehung der für eine Frontsicherung nutzbaren ukrainischen Truppen "eine zusätzlich notwendige westliche ideale Kontingentstärke von etwa 150.000 Soldaten".
Dass eine europäische "Koalition der Willigen", in welcher Besetzung auch immer, derart viele Soldaten in die Ukraine schicken kann, ist laut Einschätzung von Major und Kleemann völlig "illusorisch". Zumal es wegen der notwendigen Truppenrotationen standardmäßig eher die dreifache Anzahl von Soldaten bräuchte, um über einen längeren Zeitraum die Friedenssicherung leisten zu können.
3000 bis 5000 deutsche Soldaten?
Insofern ist der Einsatz von europäischen Friedenstruppen entlang der ukrainischen Front auf absehbare Zeit unrealistisch. Stattdessen dürfte es eher um Hilfe zur Selbsthilfe für Kiew gehen. Eine "Koalition der Willigen" könnte beispielsweise die ukrainischen Soldaten im Land selbst ausbilden, in kritischen Fähigkeitsbereichen unterstützen, strategisch beraten und Material instand halten. Die ausländischen Soldaten wären in diesem Szenario eher im Hintergrund tätig und nicht direkt an der Front. Als mögliche Einsatzorte für Friedenstruppen-Brigaden kursieren in Sicherheitskreisen zum Beispiel die Schwarzmeerstadt Odessa, etwa 100 Kilometer von der Front entfernt, oder Lwiw, 500 Kilometer westlich von der Front.
Für eine solche Mission halten Major und Kleemann eine Truppe von 10.000 oder 20.000 bis allerhöchstens 40.000 Soldatinnen und Soldaten für machbar. Wie stark die Bundeswehr sich daran beteiligen würde, ist spekulativ. 3000 bis 5000 deutsche Soldaten könnte eine realistische Zahl sein.
Wie schnell eine europäische Friedenstruppe einsatzbereit sein könnte, "hängt maßgeblich von den Rahmenbedingungen ab und der Art und Weise, wie ein Waffenstillstand oder ein Friedensschluss getroffen wird", analysiert Sicherheitsexperte Loss. Eine europäische Friedensmission könne mit den vorhandenen Mitteln und dem verfügbaren Personal und technischer Hilfe aus seiner Sicht durchaus eine mögliche Friedenslinie kontrollieren. "Das setzt aber voraus, dass Grenzen von allen Seiten akzeptiert werden und man davon ausgehen kann, dass in zwei Wochen nicht wieder russische Panzer darüber rollen."
Ohne Hilfe der USA "unvorstellbar"
Erfolgversprechend ist eine europäische Friedensmission letztlich jedoch nur, wenn die USA zumindest indirekt unterstützen. "Ohne einen Rückgriff auf US-Fähigkeiten wie strategischen Lufttransport, Logistik und Aufklärung ist eine glaubwürdige Abschreckung unvorstellbar", schlussfolgern Major und Kleemann.
Auch Loss ist überzeugt, dass die Vereinigten Staaten einer "Koalition der Willigen" nicht gänzlich fernbleiben dürften, damit eine solche Mission abschreckend auf Moskau wirkt. "In Europa fehlt die Erfahrung damit, Großverbände zu organisieren und zu führen. Diese Funktion, alle zu integrieren, können in dem Umfang nur US-Stabsoffiziere leisten", gibt der Sicherheitsexperte zu bedenken.
Sollte sich eine europäische Koalition tatsächlich dazu entscheiden, Friedenstruppen in die Ukraine zu schicken, ist laut Reisner ein robustes Auftreten dringend geboten. "Ist die eingesetzte Truppe dazu nicht in der Lage, steigt rasch die Wahrscheinlichkeit eines neuen Waffengangs. Dies sollte in jedem Fall vermieden werden", schreibt der Oberst vom Österreichischen Bundesheer. In diesem Szenario würde eine Friedenstruppen-Mission mehr schaden als nutzen.