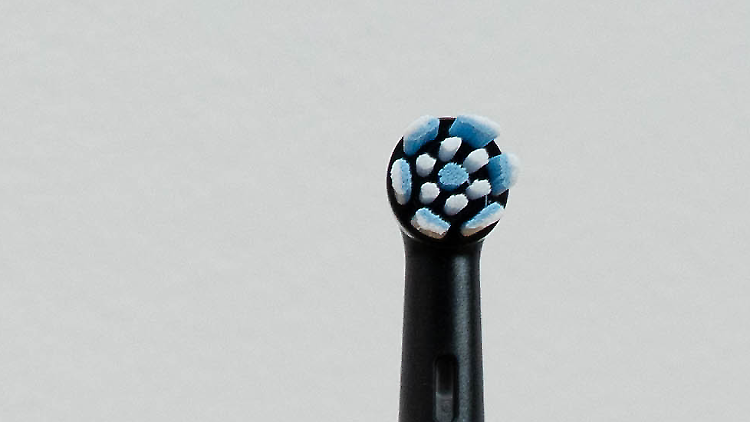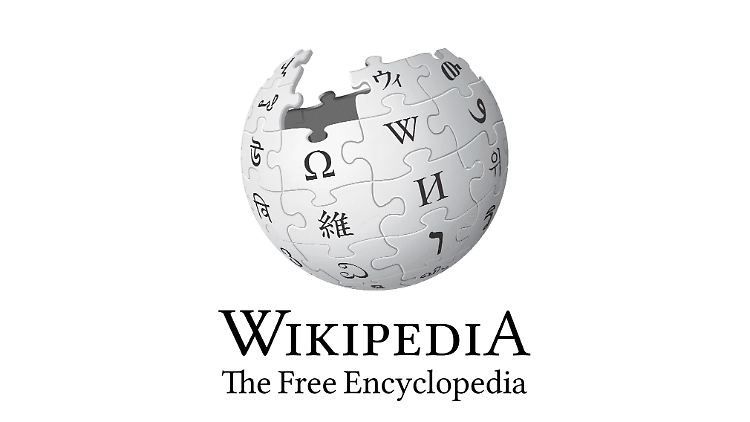Bei der Weltklimakonferenz verhandeln bis zu 10.000 Menschen aus knapp 200 Ländern. Ganz so komplex werden die Gespräche von Union und SPD nach der Bundestagswahl nicht, dennoch hat speziell das Benehmen der Union im Wahlkampf für ein gereiztes Klima gesorgt: Wie kommen beide Seiten trotz Provokationen und Verunglimpfungen zu einem Koalitionsvertrag, der vier Jahre trägt? Kai Monheim empfiehlt Friedrich Merz im "Klima-Labor", das Gespräch mit den "linken Spinnern" der SPD zu suchen. Definitiv nicht empfehlen kann der Verhandlungsexperte dagegen Nachtsitzungen: "Die sehen spektakulär aus, es kommt aber selten etwas Gutes dabei rum. Ein denkwürdiges Beispiel ist die Osterruhe der Corona-Pandemie, und die ist keine Ausnahme."
ntv.de: Die Sondierungen zwischen Union und SPD nehmen Fahrt auf. Beide Seiten haben sich bereits auf ein riesiges Finanzpaket für Verteidigung und Infrastruktur geeinigt, das noch im alten Bundestag verabschiedet werden soll. Dafür benötigen sie die Unterstützung der Grünen. Die fühlen sich allerdings ignoriert und auch "diffamiert", weil sie im Wahlkampf - genauso wie die SPD - von Friedrich Merz und der Union provoziert wurden. Ist das geschickte Verhandlungsführung von Friedrich Merz?
Kai Monheim: Ich würde bei diesen Verhandlungen weder mit Friedrich Merz noch mit Lars Klingbeil tauschen wollen, denn in diesem Wahlkampf wurde viel Vertrauen zerstört. Trotzdem muss man sich einigen. Ratsam ist auf jeden Fall, cool zu bleiben und die Emotionen unter Kontrolle zu behalten, bevor man unnötig Porzellan zerschlägt.
Kurz vor der Wahl hat Merz getönt, mit ihm werde es wieder Politik für diejenigen geben, die "alle Tassen im Schrank haben". Das Porzellan ist doch schon zerstört.
Manchmal gehen die Emotionen mit einem durch, das kennen wir aus der Wirtschaft: Selbst mit Spitzenverhandlern gehen manchmal die Gäule durch. Das kriegt man nicht zurückgedreht, kann aber damit umgehen: Man sucht das Gespräch, räumt die Sache aus dem Weg und hat die Größe, sich zu entschuldigen. Es ist wissenschaftlich unterfüttert, dass eine authentische Entschuldigung keine Schwäche bedeutet, sondern Vertrauen zurückholen kann.
Sie glauben wirklich, dass sich Friedrich Merz oder CSU-Chef Markus Söder öffentlich bei "linken Spinnern" entschuldigen werden?
Ob man das gut findet oder nicht, der Wahlkampf ist über die letzten Jahre aggressiver geworden. Gleichzeitig wissen alle, dass dieses Gepolter ein Stück weit dazugehört. Insofern ist eine große öffentliche Entschuldigung vielleicht gar nicht geboten. Das ist Teil des Theaters. Ich würde eher das private Gespräch suchen und sicherstellen, dass eine Vertrauensbasis für eine Zusammenarbeit existiert.
Sind Sie sich sicher, dass sich Merz nicht öffentlich entschuldigen muss? Nehmen Sie Lars Klingbeil und Saskia Esken, die müssen den Koalitionsvertrag doch am Ende den Abgeordneten und Mitgliedern der SPD verkaufen. Die haben doch keine Lust, einen Kanzler zu unterstützen, der sie verunglimpft, sich aber nicht entschuldigt.
Die Frage ist, wer wurde beleidigt? Das ist potenziell eine große Gruppe. Man kann schlecht einzeln abfragen, ob alles wieder in Ordnung ist. Aber wahrscheinlich wäre eine versöhnliche Botschaft in Richtung SPD-Basis nicht verkehrt, denn eine schwarz-rote Koalition würde deren Unterstützung in den kommenden vier Jahren benötigen.
Kann die versöhnliche Botschaft auch ein Koalitionsvertrag mit einer extrem roten Färbung sein, sprich: Zugeständnisse von Friedrich Merz und der Union an die SPD?
Ich denke nicht, dass man sich mit Konzessionen entschuldigen kann, denn grundsätzlich muss man in Verhandlungen zwei Ebenen unterscheiden: die emotionale Beziehungsebene, darüber haben wir gerade gesprochen, und die Sachebene. Dort wird die zukünftige Politik geklärt. Diese beiden Ebenen sollte man auseinanderhalten. Mein dringender Rat wäre also eine versöhnliche Botschaft auf der Beziehungsebene. Dann wartet man, bis das Vertrauen wieder etabliert ist und sucht auf der Sachebene nach den besten Verhandlungsergebnissen.
Die Union hat sich bereits am Wahlabend wieder sehr lobend über die "alte Dame SPD" geäußert und an ihre Standhaftigkeit in der Weimarer Republik erinnert. Bringt das etwas oder ist diese Art von Schleimerei zu durchschaubar?
Das Stichwort ist "durchschaubar": Ich kann nur raten, aus wichtigen Verhandlungen kein Schauspiel zu machen, denn ein Schauspieler meint es nicht ernst. Der schlüpft in eine Rolle. Die andere Seite ist nicht doof, das merkt sie. Ich weiß leider nicht, wie die Herrschaften der Union ihre historischen Kommentare gemeint haben, aber das sollte wirklich von Herzen kommen, sonst geht es nach hinten los. Diese Beziehungsarbeit muss man ernst nehmen. Die Psychologie wird aber auch bei Verhandlungen in der Wirtschaft speziell von vermeintlich sachorientierten Menschen oft unterschätzt. Daran sind die größten Deals gescheitert.
Ehrlichkeit und Authentizität verbindet man nicht unbedingt mit Spitzenpolitik. Hilft es denn, dass es mit Schwarz-Rot nur eine realistische Regierungsoption gibt oder erschwert diese krasse Eingrenzung die Verhandlungen ebenfalls?
Die Schwierigkeit steigt vor allem mit der Zahl der Verhandlungsparteien. Wir haben Gott sei Dank keine Situation wie bei den Klimaverhandlungen der Uno, wo bis zu 10.000 Beteiligte aus 200 Ländern um Ergebnisse ringen. Aber mit CDU und CSU hat man innerhalb der Union bereits zwei Parteien, die man unter einen Hut bringen muss. Die SPD hat auch unterschiedliche Flügel und natürlich die erwähnte Basis - dazu kommt der extreme Stress durch das Wahlergebnis der AfD.
Würden Sie auf zügige Verhandlungen drängen, damit gar nicht erst Gerüchte über schwierige Gespräche aufkommen, die das Ergebnis torpedieren könnten?
Zeitdruck ist ein zweischneidiges Schwert. Einerseits kann der Prozess damit beschleunigt werden, weil man weiß: Wir müssen fertig werden. Andererseits wissen alle, wie schwierig es ist, unter Zeitdruck Entscheidungen zu treffen. Erhöhter Druck schränkt die Kreativität von Menschen ein, es entsteht das Fliehen-oder-Kämpfen-Syndrom. Verhandler sollten konstruktiv und kreativ zum bestmöglichen Koalitionsvertrag kommen.
Wie wichtig sind Zwischenergebnisse?
Es gibt in der Verhandlungstheorie einen wichtigen Satz: Nichts ist vereinbart, bis alles vereinbart ist. Man schnürt die berühmt-berüchtigten Verhandlungspakete, dann bekommt jeder genau das, was er braucht. Die können aber auch wieder aufgeschnürt werden, wenn etwas neu bewertet wurde. Wichtig ist: Sie müssen am Ende für vier Jahre tragen.
Und das gerät in Gefahr, wenn Zwischenergebnisse ungewollt öffentlich werden und den Eindruck erwecken, dass eine Seite die andere über den Tisch zieht?
Genau, denn wie gesagt: Das sind keine bilateralen Gespräche. Hinter den Parteien stehen unterschiedliche Gruppen und auch die Öffentlichkeit. Die haben berechtigte Interessen an den Gesprächen und müssen berücksichtigt werden, sonst könnte man auch allein in einem Raumschiff verhandeln. Diese Gruppen können aber auch Unruhe stiften. Ein geschützter Rahmen ist wichtig, sonst kann man den Koalitionsvertrag auch mit 80 Millionen Bundesbürgern aushandeln.
Wie sehen gute Rahmenbedingungen aus?
Die 18 Sondierer von Union und SPD sind keine Maschinen, sondern Menschen, die unter großem Druck die wichtigsten Fragen Deutschlands beantworten müssen: Wie beenden wir die Wirtschaftskrise? Wie schaffen wir Klimaschutz? Wie gehen wir mit Migration und anderen wichtigen Themen um? In der Verhandlungsgeschichte gibt es eine Reihe von guten Beispielen, wie man so etwas hinbekommt. Beispielsweise haben die Amerikaner in den 1970er Jahren außerhalb von Washington mit Camp David extra einen Ort geschaffen, an dem Palästinenser und Israelis gute und fruchtbare Verhandlungen führen konnten.
Weil es gemütlicher und entspannter ist?
Ja, das Stresslevel wird reduziert, die Gespräche erhalten einen informellen Touch. Die Leute öffnen sich, man spielt kein Verstecken und erzählt sich keine Lügengeschichten von angeblichen roten Linien. Von Nachtsitzungen sollte man dagegen die Hände lassen. Die sehen spektakulär aus, es kommt aber selten etwas Gutes dabei rum. Ein denkwürdiges Beispiel ist die Osterruhe der Corona-Pandemie, und die ist keine Ausnahme. Um vier Uhr morgens trifft niemand gute Entscheidungen.
Kann man das nicht ausnutzen? Angela Merkel wird nachgesagt, dass sie Diskussionen stundenlang aussitzen konnte. Als alle mürbe waren, hat sie erklärt: So und so machen wir es jetzt.
Das ist wahrscheinlich der Klassiker aller Verhandlungsfragen: Handelt es sich um eine erfolgreiche Verhandlung, wenn ich einseitig meine Interessen durchgesetzt habe?
Für Donald Trump schon.
Auch Donald Trump muss sich aber überlegen, was es mit dem Gegenüber macht, wenn man sich einseitig durchsetzt.
Es fühlt sich gedemütigt?
Zum Beispiel. Bei einer Win-win-Situation gehen beide Seiten zufrieden mit einem Sieg vom Platz. Schaffe ich dagegen eine Win-lose-Situation, wird das Gegenüber versuchen, beim nächsten Mal etwas Urmenschliches zu machen, nämlich sich zu revanchieren.
Wie die Deutschen für den Vertrag von Versailles? Denen wurden nach dem Ersten Weltkrieg von den Alliierten so hohe Reparationen und Gebietsabtretungen auferlegt - das hatte maßgeblichen Einfluss auf den Beginn des Zweiten Weltkriegs.
Absolut. Man sieht sich definitiv immer zweimal im Leben. Und wenn man sich vier Jahre stabile Koalition wünscht, kann ich allen Verhandlern nur raten: Sehen Sie zu, dass am Ende beide Seiten etwas Vorzeigbares in der Hand haben. Ob die SPD am Ende drei Punkte macht und die CDU nur zwei … wen interessiert das in vier Jahren?
Mit Kai Monheim sprachen Clara Pfeffer und Christian Herrmann. Das Gespräch wurde zur besseren Verständlichkeit gekürzt und geglättet. Das komplette Gespräch können Sie sich im Podcast "Klima-Labor" anhören.