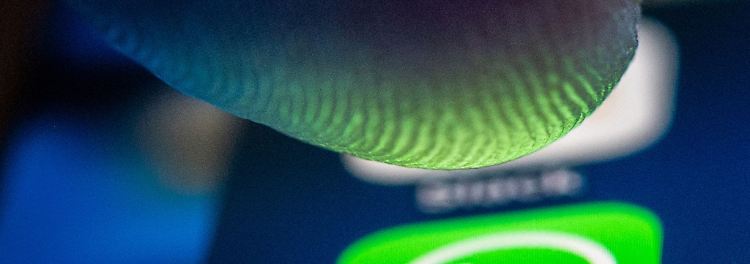>Laut EU-Kommission muss Apple eine Strafe in Höhe von 500 Millionen Euro zahlen, weil sie gegen den Digital Markets Act (DMA) verstoßen. Das Verfahren lief seit vergangenem Jahr – seither hatte die EU-Kommission nach eigenen Aussagen mehrfach klare Hinweise gegeben, wie die Firma ihre Dienste anpassen müsse, um DMA-kompatibel zu werden. Bei der heute bekannt gegebenen Strafe ging es vor allem um den App Store und die Frage, inwieweit die Firma den Zugang zu Drittanbieterstores – und damit andere Entwickler – behindert.
200 Millionen Euro soll Meta zahlen. Dabei geht es um das sogenannte Pay-or-Consent-Modell: Meta verlangt in der EU von Nutzern eine Nutzungsgebühr, wenn diese die Analyse ihres Verhaltens und eine Verknüpfung dieses Verhaltens über Plattformen hinweg ablehnen. Die EU-Kommission hatte Meta bereits im Juli 2024 mitgeteilt, dass sie in der Ausgestaltung einen DMA-Verstoß sieht. Im vergangenen November hat Meta Nachbesserungen vorgenommen, diese werden von der EU-Kommission derzeit noch geprüft, unabhängig von der heute ausgesprochenen DMA-Strafe.
Die EU-Kommissionsvizepräsidentin Henna Virkkunen betonte, dass der DMA den Schutz des Marktes für Verbraucher und Unternehmen zum Ziel habe. "In den heute angenommenen Entscheidungen wird festgestellt, dass sowohl Apple als auch Meta ihren Nutzern diese freie Wahl genommen haben und ihr Verhalten ändern müssen", sagt die Finnin, die seit Herbst 2024 für Digitales zuständig ist. Die EU-Kommission habe die Pflicht, die Rechte von Bürgern und Unternehmen in Europa zu schützen.
Transatlantisches Politikum
Meta hingegen sieht sich zu Unrecht bestraft. "Die Europäische Kommission versucht, erfolgreiche amerikanische Unternehmen zu behindern, während sie chinesischen und europäischen Unternehmen erlaubt, nach unterschiedlichen Standards zu arbeiten", heißt es in einem Statement. Es sei eine Art milliardenschwerer Zoll, die Kommission zwinge Meta, das eigene Geschäftsmodell zu ändern – hin zu einem minderwertigen Dienst. "Und durch die ungerechte Einschränkung der personalisierten Werbung schadet die Europäische Kommission auch den europäischen Unternehmen und Volkswirtschaften", schreibt Meta.
Der DMA steht seit Kurzem auch im Fokus transatlantischer Debatten – seitens der US-Administration unter Donald Trump gab es wiederholt ausdrückliche Mahnungen an die EU, US-Unternehmen nicht zu behindern. In Teilen der Administration gibt es die Auffassung, dass die EU-Regulierung und daraus folgende Strafen zollähnliche Handelshemmnisse darstellen würden, auf die Gegenzölle erhoben werden sollten. Dem hat sich Meta nun offenbar angeschlossen.
Aus einem Memorandum des US-Präsidenten vom Februar, mit dem er seine Behörden zur Prüfung angewiesen hatte, folgten bislang aber keine konkreten Ableitungen für den Umgang mit EU-Strafen. Auch einige US-Unternehmen hatten betont, dass der DMA der EU als Wettbewerbsgesetz die digitale Marktproblematik adressiere – und ihnen daher nutze, ihre Interessen gegenüber den größten Akteuren durchzusetzen.
Meta steht derzeit allerdings ebenfalls in den USA im Rahmen eines Wettbewerbsverfahrens im Fokus der dortigen Aufsichtsbehörde Federal Trade Commission. Anders als im FTC-Verfahren geht es beim europäischen Digital Markets Act nicht um eine mögliche Zerschlagung oder Entbündelung von Konzernen. Auch Googles Monopolstellung wird in den USA verhandelt.
DMA ist mächtiges Wettbewerbsgesetz
Anders als der Digital Services Act, bei dem es vor allem um Sorgfaltspflichten und Haftungsfragen von Betreibern geht, ist der Digital Markets Act Teil des Wettbewerbsrechts, mit dem für den freien Markt gefährliche Monopolstellungen und Machtmissbrauch durch dominante Akteure unterbunden werden sollen. Mit dem DMA sollte dabei den spezifischen Wettbewerbsbedingungen im digitalen Raum Rechnung getragen werden, wo Datenzugang und Interoperabilität eine große Rolle spielen.
Vor allem die sogenannte vertikale Integration von Geschäftsmodellen wie etwa im Fall von Apple, wo von der Hardwarekontrolle über die hinterlegten Daten, vom Endgerät über Betriebssysteme bis zum App Store alles aus einem Konzern stammt, war ein Grund für den DMA. Der ermöglicht der EU-Kommission als Aufsichtsbehörde zum einen, Strafen bis zu 10 Prozent des weltweiten Jahresumsatzes zu verhängen. Zum Zweiten kann die Kommission aber auch konkrete Umsetzungsmaßnahmen anordnen, etwa damit Drittanbieterstores bei iOS oder die Nutzung von Hardwarefunktionen durch Dritte nicht behindert werden.
Gegen den Bescheid der EU-Kommission können die betroffenen Unternehmen bei der europäischen Gerichtsbarkeit in Luxemburg vorgehen. In der Vergangenheit waren andere wettbewerbsrechtliche Strafen vom Europäischen Gerichtshof teilweise einkassiert worden.