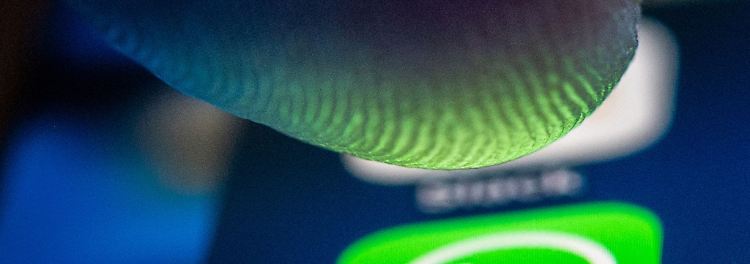Weder die Nato noch die EU können den Europäern ihre Sicherheit garantieren. Neue Bündnisse müssen her, um auf die Launen von US-Präsident Trump zu reagieren. Die Koalition der Willigen wird zur großen Hoffnung gegen den russischen Aggressor.
Die US-Regierung unter Donald Trump verliert das Interesse an der Sicherheit Europas. Eine Koalition unter der Führung von London und Paris bastelt deshalb an europäischen Verteidigungsplänen für die kriegsgebeutelte Ukraine. Details halten die beteiligten Staaten bislang geheim, um dem Russlands Präsident Wladimir Putin keinen Vorteil zu verschaffen. Die Arbeit dieser Koalition der Willigen lässt dennoch bereits zwei Schlüsse zu: Erstens wird es schwierig, die Ukraine und das restliche Europa ohne die Hilfe der USA gegen Putin zu rüsten. Zweitens suchen sich die Europäer deshalb flexiblere Gesprächsformate in Form von Bündnissen abseits etablierter Institutionen wie der EU und der Nato.
Trumps Launen schweben wie ein Damoklesschwert über der europäischen Sicherheitslage. Am Karfreitag machte der US-Präsident seinem Ärger über die stockenden Verhandlungen über den Waffenstillstand zwischen Kiew und Moskau Luft. Sowohl Trump als auch sein Außenminister Marco Rubio drohten, die Friedensgespräche abzubrechen. Derweil demonstrierte US-Verteidigungsminister Pete Hegseth Mitte April sein Desinteresse an der Nato. An einem wichtigen Treffen im Nato-Hauptquartier in Brüssel nahm Hegseth gar nicht teil, zu einem weiteren ließ er sich per Video zuschalten. Beide Termine wurden anberaumt, um über Schutztruppen und Militärhilfen für die Ukraine zu reden.
Angesichts solcher Signale aus Washington erwägen etwa 30 Länder, die sich an der Koalition der Willigen beteiligen, Soldaten in die Ukraine zu schicken. Eine offizielle Zusage gibt es bislang aber nur von den beiden Atommächten Frankreich und Großbritannien. Trotz ihrer andauernden Unterstützung Kiews gehören etwa Polen und Italien zu den Skeptikern, wenn es um die Entsendung von Truppen geht. Denn ohne die Sicherheitsgarantien der USA dürfte auch in naher Zukunft die potenzielle Präsenz Zehntausender europäischer Soldaten in der Ukraine Putin nicht abschrecken. Europa kann sich bisher nicht verteidigen ohne den nuklearen Schutzschirm der USA, ihre Truppenstärke, Militärtechnik und Logistik.
EU bleibt auf wirtschaftliche Belange festgenagelt
Noch ist vieles unklar. Doch allein die Bildung dieser Koalition belegt, wie stark sich die Kommunikation unter den europäischen Staaten wandelt. Altgediente Institutionen scheinen ungeeignet, um auf die geopolitische Eskalationsspirale, die Trump beschleunigt hat, zu reagieren. Die Nato in ihrer aktuellen Form ist wenig verlässlich, solange die USA sie mit ihrer derzeitigen Regierung offiziell anführen. Die EU bleibt auf wirtschaftliche Belange festgenagelt, da ihre Mitgliedstaaten die Hoheit über ihre Verteidigungspolitik nicht abgeben wollen. Zudem erschweren Quertreiber wie der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban außenpolitische Beschlüsse in Brüssel. Der Putin-Vertraute Orban kann nach Belieben blockieren, weil für die Außenpolitik der EU stets eine einstimmige Entscheidung der Staats- und Regierungschefs getroffen werden muss.
Aus diesem Grund setzen viele Experten ihre Hoffnung auf die Koalition der Willigen, damit die Europäer wieder handlungsfähig werden. Darunter ist der Politologe Herfried Münkler: "Die mögliche neue Struktur zeigt sich bereits", sagte Münkler im Gespräch mit ntv.de. "Immer wieder treffen sich die Außen- und Verteidigungsminister des Weimarer Dreiecks - Frankreich, Deutschland, Polen - plus Italien. Vielleicht könnten die Spanier dazukommen und vor allem die Briten als Nato-Mitglieder, die zwar nicht mehr in der EU sind, sich ihr aber wieder annähern."
Diese europäischen Staaten sollten aus seiner Sicht künftig die Außen- und Sicherheitspolitik Europas an sich ziehen, sowohl auf Nato-, als auch EU-Ebene. Sie können andere Länder einladen, mitzumachen, müssten aber stets nach dem Mehrheits- und nicht mehr nach dem Einstimmigkeitsprinzip entscheiden, fordert Münkler. Dies würde einen tiefgreifenden Wandel der EU bedeuten. An die Stelle des Vetorechts für jeden einzelnen Staat träten Mitgliedschaften verschiedenen Ranges, geordnet anhand der Rechte und Pflichten der einzelnen Länder.
Le Pen als Frankreichs Präsidentin wäre Gefahr
Eine ähnliche Entwicklung prognostiziert Konfliktforscherin Nicole Deitelhoff. "Europa ist dabei, sich vor unseren Augen zu erneuern und zu verändern", sagte Deitelhoff ntv.de: "Es gibt ja nicht nur das Format der Koalition der Willigen, sondern auch die 'Group of Five'. Zu diesem Fünfermodell gehört neben Deutschland, Frankreich, Italien und Polen auch Großbritannien." Nach der Lähmung der europäischen Außenpolitik sieht sie in der aktuellen Offenheit der Europäer eine Chance, neue Formate auszuprobieren. "Diejenigen, die weitergehen wollen, schließen sich zusammen, ohne die anderen zu bestrafen", so Deitelhoff.
Absprachen innerhalb einer solchen Koalition der Willigen hat nicht nur Vor-, sondern auch Nachteile. Entscheidungen haben mehr Gewicht, wenn sie ausnahmslos von allen Staats- und Regierungschefs der EU getroffen werden. Auch könnten sich kleinere, unbedeutendere Länder von der Übermacht der größeren noch mehr vor den Kopf gestoßen fühlen - das ist in der EU bereits der Fall. Zudem steht die Koalition auf wackligen Beinen, wenn in einem der führenden Staaten Rechtspopulisten an die Macht kommen, die sich nicht wie Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni sowohl EU- als auch Ukraine-freundlich geben; sei es auch nur vordergründig. Was etwa passiert, falls in Frankreich Marine Le Pen zur Präsidentin gewählt würde?
Eine französische Präsidentin Le Pen wäre für den Politologen Timo Lochocki ein Horrorszenario, vor allem in Bezug auf die Diskussion um die nukleare Abschreckung der Europäer ohne die USA. Keinesfalls sollten sich die Europäer aus seiner Sicht auf französische statt amerikanische Atomwaffen verlassen. "Wir gehen weg von den USA, weil die gerade dabei sind, ein autokratisches System zu werden, und wollen sie durch die Franzosen ersetzen, denen nach den nächsten Präsidentschaftswahlen das gleiche Schicksal drohen könnte", sagte Lochocki ntv.de.
Berlin könnte sich auch mit nord- und osteuropäischen Staaten zusammentun
Auch eine gesamteuropäische Lösung, bei der die Franzosen oder die Briten ihre Nuklearstreitkräfte unter einen europäischen Oberbefehl stellen würden, hält er für wenig aussichtsreich. "Daher ist aus meiner Sicht die sinnvollste Lösung, dass die nordeuropäischen und mittelosteuropäischen Staaten eine gemeinsame nukleare Abschreckung aufbauen", so Lochocki. Dieses völlig andere Bild einer Koalition der Willigen nennt Lochocki "Hanse 2.0". Dem Zusammenschluss könnten Spanien und Portugal beitreten. Eine Teilnahme Frankreichs, Italiens und Ungarns hält er aufgrund des Erstarkens der Rechtsextremen in diesen Ländern für unwahrscheinlich.
Welche Form auch immer die Koalition der Willigen künftig einnehmen wird, am Ende hat sie keine Wahl. Ohne die Hilfe der USA wird es an ihr liegen, Europa gegen Putin zu rüsten.