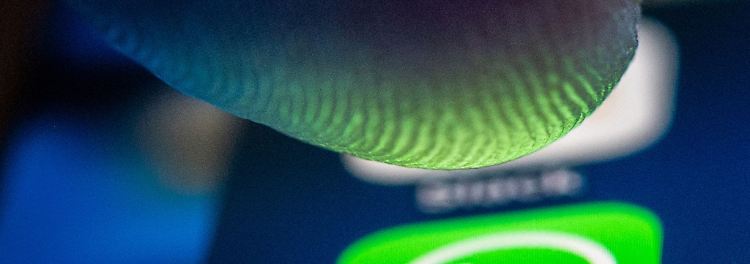Die Vereinigten Staaten möchten Zugang zu strategisch wichtigen ukrainischen Rohstoffen, sind aber kaum zu Gegenleistungen bereit. Kiew versucht es inzwischen mit einer zweigleisigen Strategie.
Niemand im politischen Kiew hat sich die Zusammenarbeit mit der neuen US-Regierung des 47. Präsidenten Donald Trump als leicht vorgestellt. Dass es so schwer werden würde und sich die Ukraine nun ernsthaft fragen muss, ob sie Washington überhaupt noch als Partner betrachten kann, lag in dieser Form jedoch abseits der Vorstellungskraft.
In diesen Tagen hat sich die Lage wegen der Verhandlungen über ein mögliches Ende des russisch-ukrainischen Krieges noch einmal verschärft. Und dies nicht nur wegen des neuen Posts Trumps auf Truth Social, in dem er seinen ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj erneut hart angriff. Es scheint die Regel und keine Ausnahme zu sein, dass die USA in ihrer angeblichen Vermittlerrolle stets mehr Druck auf die schwächere Ukraine statt auf den Aggressor Russland ausüben.
Im Hintergrund müssen sich die Ukrainer in den komplizierten amerikanisch-ukrainischen Beziehungen unverändert auch mit einem anderen Thema beschäftigen. Bei den Gesprächen über das beabsichtigte Rohstoff-Abkommen der beiden Länder ist Kiew ebenfalls enormem Druck aus Washington ausgesetzt. Schon am 28. Februar, als der Eklat im Weißen Haus zwischen Trump, seinem Vize JD Vance und Selenskyj die politische Welt erschütterte, sollte im Oval Office ein Rahmenabkommen zur gemeinsamen Nutzung der ukrainischen natürlichen Ressourcen unterschrieben werden. Was aber nicht geschah.
Nach zähen, weiteren Verhandlungen haben inzwischen US-Finanzminister Scott Bessent und die ukrainische Vizeregierungschefin Julija Swyrydenko, die ebenfalls als Wirtschaftsministerin agiert, eine kurze und aus ukrainischer Sicht unter Umständen akzeptable Absichtserklärung unterschrieben. Nun befindet sich der Ministerpräsident Denys Schmyhal in den USA und verhandelt unter anderem mit Bessent über das vollumfängliche Abkommen. Es ist unwahrscheinlich, dass das Dokument, wie von der US-Seite gewünscht, wirklich innerhalb von wenigen Tagen unterschrieben wird. Gemäß der Absichtserklärung müssen die Verhandlungsteams bis zum 26. April über ihre Fortschritte berichten. Somit drängt das Trump-Team wie gewohnt zur Eile, während die Ukraine aus gutem Grund versucht, auf Zeit zu spielen.
Investoren suchen Sicherheit
Die gesamte Verhandlungssituation um das Abkommen und das Thema der Rohstoffe selbst sind heikel. Es birgt innenpolitischen Sprengstoff und kann auch von der russischen Propagandamaschine instrumentalisiert werden. Ursprünglich stammt die Idee der gemeinsamen Nutzung der strategischen Ressourcen der Ukraine von Präsident Selenskyj selbst. Sie war Teil seines im Herbst 2024 vorgestellten Siegesplanes. Der Vorschlag war von Anfang an auf "Dealmaker" Trump ausgerichtet, um ihm im Fall eines Wahlsiegs Argumente dafür zu geben, die Ukraine weiter zu unterstützen. Schließlich war ohnehin klar, dass unter Trump die Zeiten der kostenlosen Hilfen an Kiew vorbei sein würden.
Tatsächlich verfügt die Ukraine über reiche Bodenschätze. Dabei geht es nicht ausschließlich um die Seltenen Erden, die lange medial im Vordergrund standen, sondern unter anderem auch um für verschiedene Elektronik wichtigen Lithium und Titanium. Die Ukraine hat im europäischen Vergleich beachtliche Vorkommen. Die nötigen geologischen Erkundungen dauern allerdings Jahre und sind teuer. Hinzu kommen verschiedene ökologische und bürokratische Probleme.
Während der ukrainische Staat nicht über das Geld verfügt, dies perspektivisch anzugehen, haben aufgrund der schwierigen Sicherheitslage seit dem Ausbruch des Donbass-Krieges nur wenige Investoren es gewagt, ihr Geld zu riskieren. Viele potenzielle Förderstätten liegen in den östlichen Regionen des Landes. Daher wurde bereits vor der russischen Vollinvasion im Februar 2022 nur in rund 15 Prozent der ukrainischen Lagerstätten auch aktiv abgebaut. Ein Konstrukt, in dem die USA der Ukraine Sicherheitsgarantien geben und große US-Konzerne zugleich in die Förderung im Land investieren, erschien deshalb sinnvoll. Zudem hätte dies der Stammwählerschaft Trumps erklären können, warum sich die Geschäfte mit der Ukraine und deren militärische Unterstützung lohnen.
Druck, Druck, Druck
Trumps Team hatte jedoch eine andere Vorstellung – und weigert sich vehement, über jegliche seriösen Sicherheitsgarantien für Kiew zu sprechen. Stattdessen setzt man auf Druck. Schon bei den ersten Verhandlungsrunden und somit vor dem Streit im Weißen Haus war das sichtbar. Die amerikanischen Verhandler hatten Medienberichten zufolge mindestens fünf aus ukrainischer Perspektive inakzeptable Entwürfe auf den Tisch gelegt, bis man sich auf den größtenteils nichtssagenden Text einigen konnte, der am besagten 28. Februar hätte unterzeichnet werden sollen. Nun also der zweite Versuch, bei dem die US-Seite aber noch einmal einen draufgelegt hat.
Zunächst erhielt die ukrainische Regierung am 23. März einen 56-seitigen Dokumententwurf, der einem Ausverkauf der Ukraine an die USA ähnelte. Laut diesem Entwurf hätten die US-Amerikaner nicht nur Anspruch auf zukünftige Förderstätten, sondern auch auf die bereits funktionierende Infrastruktur, unter anderem für Gas und Öl. Dies wurde in Kiew mit großem Erstaunen aufgefasst. Ein wirkliches Mitspracherecht bei der Arbeit des gemeinsamen Fonds, der formell in den Wiederaufbau der Ukraine investieren sollte, hätte die Ukraine nicht. Der Vorstand wären drei US-Amerikaner und zwei Ukrainer gewesen. Der große Knackpunkt war aber: Der Entwurf sah de facto keine wirkliche Gegenleistung seitens der USA vor. Kiew hätte demnach akzeptieren müssen, dass die vom Kongress unter Ex-US-Präsident Joe Biden verabschiedeten Hilfen als Kredit bewertet und nun zurückgezahlt werden müssen.
Einen großen Skandal machte die ukrainische Regierung daraus nicht und versuchte stattdessen, im Hintergrund mithilfe einer eigens beauftragten Ex-Kanzlei mit den US-Amerikanern sogenannte "technische Verhandlungen" zu führen. Zumindest im ersten Schritt scheint dies funktioniert zu haben, wie die Unterzeichnung der Absichtserklärung zeigt. Ist das für Kiew zielführend? Dies wird sich erst in den nächsten Tagen und Wochen zeigen.
Letztlich sind die Inhalte des kompletten Abkommens entscheidend. Und da bleibt das Hauptproblem: Es ist kaum vorstellbar, dass Donald Trump jegliche Sicherheitsgarantien für die Ukraine mit dieser Vereinbarung verknüpfen wird. Ohne solche Garantien ist es aber zugleich kaum bis gar nicht vorstellbar, dass große US-Konzerne in der Ukraine überhaupt investieren. Denn selbst im Falle eines halbwegs erfolgreichen Waffenstillstandes im russisch-ukrainischen Krieg ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die Kämpfe an einem beliebigen Tag wieder aufflammen würden.