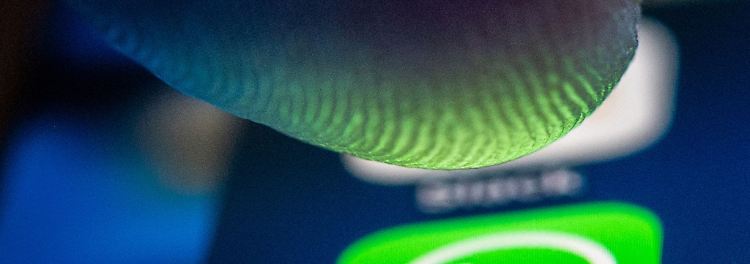Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig umwirbt die SPD-Basis, für den Koalitionsvertrag mit der Union zu stimmen. SPD und CDU müssten gleichermaßen durch gutes Regieren Vertrauen zurückgewinnen. Dass das gelingen kann, dessen scheint sie sich selbst nicht ganz sicher zu sein.
Manuela Schwesig ist jetzt Team Merz. "Ich wünsche mir wirklich, dass - und ich meine es sehr, sehr ernst -Friedrich Merz und diese mögliche Koalition und Regierung Erfolg hat", sagt die Sozialdemokratin und Regierungschefin von Mecklenburg-Vorpommern im Bürgerhaus Güstrow. In der geografisch mittig ihres Bundeslandes gelegenen Kleinstadt erscheint Schwesig am Mittwoch nach Ostern zur SPD-Dialogkonferenz. Mehr als zwei Stunden nimmt sie sich an diesem sonnigen Frühlingsabend Zeit, um mit einem überschaubaren Publikum das Für und Wider des Koalitionsvertrags mit CDU und CSU zu diskutieren. Rund 70 Sozialdemokraten sind erschienen, darunter auch Mitglieder der Landesregierung und SPD-Landtagsfraktion. Ein paar Dutzend Zuschauer schauen via Livestream zu.
Aber jede Stimme zählt. Niemand kann sicher sagen, ob die SPD-Basis der Koalition mit den Unionsparteien zustimmen wird. Mindestens 20 Prozent der 358.322 SPD-Mitglieder müssen an dem am 29. April endenden Mitgliederentscheid teilnehmen und davon mindestens die Hälfte "Ja" ankreuzen, damit das Bündnis unter einem CDU-Bundeskanzler Merz zustande kommt. Deshalb kommt es womöglich auch auf die nur 2800 Sozialdemokraten im am dünnsten besiedelten Bundesland an.
Dort wo zur Bundestagswahl satte 35 Prozent der Zweitstimmen an die AfD gingen und nur 12,4 Prozent an die SPD. Wo weder SPD noch CDU auch nur ein Mandat gewinnen konnten, weil alle sechs Wahlkreise an die AfD gingen. Wo im Mai vier Landratsposten neu vergeben werden und Schwesig im Herbst 2026 als Landeschefin wiedergewählt werden will. Wo Sozialdemokraten oft Teil einer Minderheit sind, die sich gegen eine rechtsradikale Meinungsmacht stemmt. Und wo sich selbige Sozialdemokraten nicht sicher sein können, ob die CDU und ihr Vorsitzender Merz irgendwann doch wieder gemeinsame Sache mit der AfD machen werden.
Schwesigs Horrorszenario
"Es ist teuer, meine Stimme zu kaufen bei der Frage, Friedrich Merz zum Kanzler zu machen", lässt SPD-Mitglied Markus wissen. Er ist einer der ersten Fragesteller nach Schwesigs kurzem Impulsvortrag. Und er fragt: "Wie läuft das jetzt weiter? Wird das am Ende doch wie eine Ampel, wo ständig nachverhandelt wird und wir ständig etwas in der Presse lesen?" Was der junge Mann umschreibt, ist Schwesigs Horrorszenario. Sie will jetzt unbedingt das Gegenteil erleben von dem, was die Ampelkoalition in ihrer Außendarstellung geliefert hat.
Jeder habe es im Wahlkampf gespürt, in Mecklenburg-Vorpommern und in den anderen ostdeutschen Ländern: Die Leute "wollten Olaf Scholz und die SPD nicht mehr und sie wollten auch nicht mehr zur CDU", sagt Schwesig. "Unser Problem ist doch, dass wir einen riesigen Vertrauensverlust haben." Die "einzige Chance, wieder Vertrauen zurückzugewinnen", sei, dass "Friedrich Merz als Kanzler, mit einer Regierung, die Stabilität und Verlässlichkeit ausstrahlt", die im Koalitionsvertrag vereinbarten Punkte umsetzt.
CDU und SPD im selben Boot auf stürmischer See, so sieht das Schwesig. Niemanden interessiere wirklich, welche Partei sich bei welchen Punkten im Koalitionsvertrag stärker durchgesetzt habe. "Meine Erfahrung ist: Die Bürger wissen, dass man nicht alles auf einmal lösen kann, aber sie wollen Klarheit und sie wollen eine Perspektive", sagt Schwesig. "Ich wünsche mir wirklich, dass es jetzt anders läuft, dass es keine Streitereien mehr gibt." Gelingt dies nicht, kann sich Schwesig die Mühen des anstehenden Landtagswahlkampfes sparen. Dann überschattet das schlechte Image der Bundesparteien alle Erfolge, die sie sich und ihrer rot-roten Landeskoalition auf die Fahne schreibt.
Ernüchterung über Ostern
Doch die vergangenen Tage treiben der seit bald acht Jahren amtierenden Ministerpräsidentin schon wieder Sorgenfalten in das 50 Jahre junge Gesicht: "Ich bin aus den Koalitionsverhandlungen möglichst positiv rausgegangen, weil ich das Gefühl hatte, wir haben jetzt eine ganze Menge auch Gutes verabredet", sagt Schwesig. "Und dann war ich auch sehr ernüchtert, wie es über Ostern schon wieder gelaufen ist." Die von CDU-Politiker Jens Spahn losgetretene Debatte über einen anderen Umgang mit der AfD, die führende Sozialdemokraten auf die Palme brachte. Oder der öffentlich ausgetragene Streit zwischen SPD und CDU, ob der Mindestlohn nun verbindlich auf 15 Euro angehoben wird.
Schwesig deutet die Mindestlohn-Einigung so, dass alle Regierungsparteien dieses Ziel unterstützen, sich aber nicht einmischen werden in die Entscheidung der Mindestlohnkommission aus Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern. "Das ist jetzt aber aus meiner Sicht erforderlich, dass keiner der beiden Seiten diesen Weg infrage stellt."
Manuela Schwesig, die die Genossen in Berlin ermahnt: Das hat in diesen Wochen ein ganz anderes Gewicht, nachdem sie im Zuge der Nordstream-Affäre ihrer Regierung schon einmal abgemeldet schien. Nun aber gehörte Schwesig zu den maßgeblichen Verhandlerinnen des Koalitionsvertrags und hat dem Vernehmen nach Eindruck hinterlassen bei ihren Gegenübern aus CDU und CSU. Wenn sie gewollt hätte, Schwesig hätte Bundesministerin oder Parteivorsitzende werden können. Doch bislang wiegelt sie ab.
Sie wolle ihr Ostsee-Bundesland gegen die blaue Welle verteidigen. In eineinhalb Jahren laute die Frage: "Manuela Schwesig und die SPD oder die AfD?" Es dürfte ein ähnlich personalisierter Wahlkampf werden wie in Brandenburg im vergangenen Sommer. Trotz positiver wirtschaftlicher Entwicklung konnten sich die Sozialdemokraten nur an der Macht halten, weil der ähnlich beliebte Ministerpräsident Dietmar Woidke seinen Verbleib davon abhängig machte, dass die Menschen seine SPD zur stärksten Kraft wählten- vor der AfD. Das Wagnis gelang, trotz damals noch regierender Ampel und der miserabel angesehenen Scholz-SPD.
Warnung an Merz
Wer künftig das Gesicht der Bundes-SPD prägen wird, ist noch nicht raus. Partei- und Fraktionschef Lars Klingbeil könnte Bundesfinanzminister werden. Der beliebte Boris Pistorius dürfte Verteidigungsminister bleiben. Es wird auch weiter einen Ostbeauftragten der Bundesregierung geben, darauf hat Schwesig im Bündnis mit den anderen Ostregierungschefs bestanden. Es wird wieder ein Sozialdemokrat. "Für mich waren es die vierten Koalitionsverhandlungen auf Bundesebene und ich fand sie am schwersten", sagt Schwesig und meint damit vor allem die diversen Herausforderungen, mit denen die kommende Bundesregierung konfrontiert ist.
"Ich hätte nicht gedacht am Anfang, dass wir in den Verhandlungen so viel herausholen", sagt sie insbesondere mit Blick auf das 500 Milliarden Euro schwere Schuldenprogramm für die Infrastruktur und die weitgehende Ausnahme der Verteidigungsausgaben von der Schuldenbremse. Die Mehrheit der Wähler mag nicht interessieren, welche Partei sich wie stark durchgesetzt hat. Die SPD-Mitglieder, die nun dem Koalitionsvertrag ihr Okay geben sollen, wollen das aber schon wissen.
Und so versichert Schwesig ihnen, man habe "sehr ernsthaft mit Friedrich Merz darüber gesprochen, dass wir durch seinen Wortbruch im Bundestag ein Vertrauensproblem haben". Merz wird also nicht noch einmal eine Gesetzesmehrheit mit AfD-Stimmen herbeiführen. Was aber, wenn seine Partei dies auf Landesebene tut? Das Thema AfD wird der Koalition erhalten bleiben und so wirbt Schwesig für die gefundenen Kompromisse in der Migrationspolitik. Es sei an der "Zeit, dass wir bei schweren Straftätern und Gefährdern, die nur eine kleine Gruppe sind, die aber die Stimmung für alle anderen vergiften, dass wir da klarer werden, dass es da eine Bundeszuständigkeit gibt, dass wir da konsequenter werden", sagt Schwesig. "Damit nicht mehr dieses Gefühl da ist 'da werden doch eigentlich die Falschen abgeschoben und die, die hätten abgeschoben werden müssen - wie Straftäter -da kriegt ihr es nicht hin'."
"Das habt ihr wunderbar gemacht"
Schwesig fordert - auch zum Unmut mancher Genossen - schon länger und lautstark eine konsequente Abschiebung aller Menschen ohne Bleiberecht, insbesondere aber von Straftätern und Gefährdern. Für sie ist das eine Frage des Gerechtigkeitsempfindens, das ihr im zunehmend AfD-lastigen Mecklenburg-Vorpommern im Gespräch mit den Menschen entgegenschlägt.
Dennoch kritisieren einige Fragesteller in Güstrow das Nachgeben der SPD bei der Aussetzung des Familiennachzugs für subsidiär Schutzbedürftige - sprich Kriegsflüchtlinge - und dass zur Abschiebung festgenommenen Personen nicht mehr zwingend ein Rechtsanwalt zur Seite gestellt werden soll. Zweifel gibt es auch, ob die SPD beim Mindestlohn oder einer Reichensteuer hart genug verhandelt hat. Es werden Wünsche geäußert, wohin die zusätzlichen Ländermittel aus dem Sonderschuldenprogramm fließen sollen - mehr Lehrer, zuverlässigere Schulbusse etwa.
Scharfe Kritik aber bleibt aus. Der Parteinachwuchs der Jusos im Land hat sich zwar gegen den Koalitionsvertrag ausgesprochen, so wie die anderen Juso-Landesverbände auch. Doch kein Juso-Funktionär ist im Bürgerhaus Güstrow zugegen, niemand macht Stimmung für ein "Nein" beim Mitgliederentscheid. Nur ein ehemaliger Ortsbeirat aus der Plattenbau-Siedlung Rostock-Dierkow, wo die SPD einen besonders schweren Stand zu haben scheint, bekennt sich zu seiner ablehnenden Haltung. "Das habt ihr wunderbar gemacht", lobt der Mann die SPD-Verhandler. "Ich habe aber trotzdem dagegen gestimmt." Er ist der einzige bekennende Nein-Sager an diesem Abend.