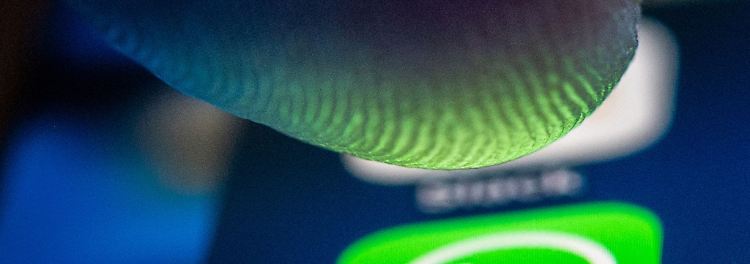>Im derzeit vorliegenden Koalitionsvertrag von CDU, SPD und CSU erklären die Parteien, dass sie zukünftig stark auf "Digital Only" setzen wollen. Dieser Vorsatz könnte einige Bevölkerungsteile aber erheblich unter Druck setzen. Die Wirtschaftsinformatikerin Prof. Dr. Doris Weßels plädiert dafür, diese Gruppen umfassender sichtbar zu machen, aber auch adäquat anzusprechen – zielgruppengerecht. Eine der größten Gruppen stellen ältere Frauen dar. Warum gerade diese einen geringeren Bezug zur Digitalisierung haben, erklärt Weßels im Interview mit heise online.
Aus dem Koalitionsvertrag: "Wir setzen auf konsequente Digitalisierung und "Digital-Only": Verwaltungsleistungen sollen unkompliziert digital über eine zentrale Plattform ("One-Stop-Shop") ermöglicht werden, das heißt ohne Behördengang oder Schriftform. Jeder Bürger und jede Bürgerin erhält verpflichtend ein Bürgerkonto und eine digitale Identität."
(Bild: D21-Digital-Index 2024/2025)
Laut dem D21-Digital-Index 2024/2025 sind 64 Prozent der Offliner weiblich und nur 36 Prozent männlich. 88 Prozent von ihnen sind "im Ruhestand, und für ihren privaten Alltag sehen sie keinen Bedarf, sich digitale Fähigkeiten anzueignen. Sie glauben nicht, dass sie persönlich von der Digitalisierung profitieren." Gemessen an der Gesamtbevölkerung ab 14 Jahren sind insgesamt 6 Prozent Offliner (4,2 Mio.) Rund 52 Prozent der deutschen Gesamtbevölkerung stehen der Digitalisierung distanziert, skeptisch oder ablehnend gegenüber.
Prof. Dr. Doris Weßels ist Professorin für Wirtschaftsinformatik und Mitgründerin des Kompetenzzentrums Künstliche Intelligenz und wissenschaftliches Arbeiten (VK:KIWA). Im Rahmen des KI-Anwendungszentrums Schleswig-Holstein leitet sie das Zukunftslabor Generative KI und betreut gemeinsam mit ihrem Team vielfältige KI-Projekte aus der Wirtschaft, Wissenschaft und Bildung. Neben ihren Tätigkeiten als Aufsichtsrätin und Keynote-Speakerin ist sie Mitglied diverser nationaler und internationaler KI-Gremien.
Frau Prof. Dr. Weßels, Sie haben während der Bitkom Bildungskonferenz über KI, Lernsysteme und das lebenslange Lernen unter der Überschrift "KI ist für alle da" gesprochen. Dort haben Sie auch darauf hingewiesen, dass insbesondere ältere Frauen zu den digital Abgehängten gehören, die eigentlich mit Weiterbildungen erreicht werden müssten. Das Ganze hat auch einen Namen: Gender Digital Divide. Warum ist der so deutlich sichtbar in Deutschland?
Zunächst müssen wir einmal schauen, welche Generationen das genau betrifft. Also: Über wen sprechen wir hier?
Kürzlich gab es einen Tagesschaubericht, der beleuchtet hat, wie die digitale Teilhabe bei uns in Deutschland aussieht. Die älteste Gruppe der Befragten waren die 65- bis 74-Jährigen, von denen rund zwölf Prozent noch nie im Internet gewesen sind. Das bedeutet, dass jede achte Person in dieser Altersgruppe ein digitaler Außenseiter bzw. Offliner ist. Ich habe mich aber auch gefragt: Wieso hört die Analyse bei den 74-Jährigen auf und müssen wir uns nicht auch ältere Kohorten in unserer Gesellschaft ansehen? Einer Studie der OECD zufolge liegt die durchschnittliche Lebenserwartung in Deutschland derzeit bei rund 81 Jahren, bei Frauen liegt sie mit 83 Jahren ca. 5 Jahre höher als bei Männern mit 78 Jahren. Wir sind eine alternde Gesellschaft und ein relevanter Teil der Bevölkerung wird offensichtlich gar nicht mehr befragt. An diese Gruppe kommt man aber auch nicht so leicht heran, weil sie – so zu vermuten – digital kaum erreichbar ist oder im Digitalen nicht sichtbar wird.
Durch den D21-Digital-Index ist aber auf jeden Fall klar, dass es tatsächlich einen Digital Divide gibt, der auch deutliche Geschlechtsunterschiede zeigt. Sie zeigen sich in Bezug auf Nutzungsverhalten, digitale Affinität, in Bezug auf die Selbsteinschätzung der eigenen digitalen Kompetenzen oder überhaupt Zugängen zu Technik.
Die Frauen, die heute 80 Jahre oder auch älter sind, waren vielfach "nur" Hausfrau und Mutter und nicht berufstätig. Aufgrund dieses klassischen Rollenbildes haben sie im Gegensatz zu ihren Männern die zunehmende Digitalisierung am Arbeitsplatz nicht kennengelernt, weil es keine Berührungspunkte für sie gab. Das hatte zur Folge, dass sie häufig keinen Zugang zu diesen Werkzeugen gefunden haben und sich darauf verlassen haben, dass ihr Ehemann oder Partner diesen technischen Part übernimmt oder vielleicht hinterher die Kinder, die dann zur Unterstützung eingesprungen sind.
Ich kann das selbst bei meiner 93-jährigen Mutter beobachten. Sie ist Beobachterin des Nutzungsverhaltens ihrer Kinder und Enkel, aber hat selbst kaum einen Zugang, schaut Fernsehen und liest die Tageszeitung in Papier.
Wenn man sich die Gleichberechtigungsgeschichte in Deutschland anguckt, kam zwar 1918 das Frauenwahlrecht, aber eine eigene Vermögensverwaltung mit eigenem Konto wurde erst 1958 gesetzlich erlaubt. Auch die Berufstätigkeit von Frauen war lange eingeschränkt, da Ehemänner bis 1977 diese verbieten konnten. Wie Sie schon angemerkt haben, konnte eine Berufstätigkeit dazu beitragen, einen Zugang zu Digitalität zu erlangen. In Bezug auf ältere Frauen gab es also klare strukturelle Hürden.
Nun ist es so, dass im aktuellen Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD unter anderem das Prinzip "Digital Only" für Verwaltungsleistungen als Ziel ausgegeben wird. Dadurch müssten Offliner zwangsläufig zu Onlinern werden. Wie kann man den bisher abgehängten Gruppen digitale Angebote besser zugänglich oder sogar schmackhaft machen?
Bevor wir darüber reden, müssen wir zunächst einen Schritt zurückgehen. Oft scheitert es schon an den finanziellen Rahmenbedingungen. Die Endgeräteanschaffung, der Internetzugang – das sind zusätzliche Belastungen. Im Jahr 2023 hat die gesetzliche Rente aus Altersgründen bei durchschnittlich 1.099 Euro im Monat gelegen, wobei Frauen im Schnitt nur 903 Euro erhalten haben. Für jüngere Frauen gibt es auch heute noch geschlechtsbedingte Gehaltsunterschiede, oder weil aufgrund von Care-Arbeit in Teilzeit gearbeitet wird. Aber zurück zu den älteren Kohorten.
Nach der Anschaffung will die Infrastruktur auch verstanden und gepflegt werden. Diese Hürde muss zunächst einmal genommen werden. Allerdings gibt es auch klare Mehrwerte. Unter anderem, wenn es um die Punkte gesellschaftliche Teilhabe und Vermeidung von Vereinsamung im Alter geht. Kommunikationsapps mit Videocalls können helfen, wenn ältere Menschen alleine leben und nicht mehr gut mobil sind – man denke nur an die vielen älteren Frauen, die als Witwen alleine leben. Für ältere Menschen könnte es auch attraktiv sein, beim Einzelhändler den Wocheneinkauf mit Lieferung oder in der Apotheke die Medikamente und Pflegeprodukte online bestellen zu können. Hinzu kommt die Möglichkeit, bei immer weniger Bankfilialen vor Ort die Bankgeschäfte online zu tätigen. Solche Angebote können das Leben erleichtern und verschönern und damit den Schritt vom Off- zum Onliner erleichtern.
Es muss aber Menschen geben, die bei der Infrastrukturbeschaffung, der Nutzung und Wartung helfen. Dieser Support fällt nicht vom Himmel. Teilweise wird so etwas über Volkshochschulangebote oder Senioren-Netzwerke gestemmt, aber das ist regional in den Gemeinden und Kommunen sehr unterschiedlich.
Selbst wenn jemand Interesse an der digitalen Teilhabe hat, sogar Vorteile sehen könnte, hängt es also wieder von vielen individuellen, aber auch strukturellen Faktoren ab, ob die dann tatsächlich erreicht werden kann. Dass alle Bevölkerungsgruppen den Umgang mit digitalen Tools lernen und auch Medienkompetenz erlangen sollten, wird im Koalitionsvertrag aber stark betont: Dort heißt es: "Der souveräne, sichere und kritische Umgang mit digitalen Tools und Medien steigert die Resilienz unserer Gesellschaft, die Wehrhaftigkeit unserer Demokratie und die Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft." Die Koalition will deshalb eine "altersübergreifende digitale Kompetenzoffensive" starten. Das klingt erst einmal sinnvoll, aber ist das so einfach möglich?
Ich sehe das Problem, dass zwar schon lange im beruflichen Kontext davon gesprochen wird, dass wir lebenslang lernen müssen. Die 3 L als Akronym wurden wie ein Mantra gepredigt, aber in der Vergangenheit nicht wirklich praktiziert. Es herrscht noch erschreckend häufig die Meinung vor, dass nach der Berufsausbildung das aus der Schule bekannte Lernen "glücklicherweise und endlich" aufhört. Auch an dieses Mindset müssen wir ran und den Wert von digitaler Bildung für das berufliche und private Leben stärker vermitteln.
Der Bitkom hat sich während der Koalitionsverhandlungen deshalb dafür starkgemacht, dass auf Bundesebene eine Bundeszentrale für digitale Bildung eingerichtet werden sollte. Das steht nun nicht im Koalitionsvertrag. Aber was halten Sie von der Idee?
Ich finde die Idee grundsätzlich sehr gut, weil es den Paradigmenwechsel zum lebenslangen Lernen unterstreichen würde. Lernen wird leider sehr häufig als Belastung empfunden, das keinen praktischen Nutzen hat und daher negativ konnotiert. Gerade für die älteren Bevölkerungsgruppe benötigen wir zielgruppengerechte, niedrigschwellige und möglichst inklusive Angebote.
Alleine durch die mittlerweile breite Verfügbarkeit von KI spüren wir nun, dass dieses lebenslange Lernen tatsächlich notwendig ist. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es sich stark beschleunigt hat und zukünftig vermutlich noch rasanter verlaufen wird. Das sehe ich so intensiv wie nie zuvor in meinem Leben und jeden Tag in meinem Umfeld. Aber das sollte keine Abschreckung sein. Mir macht das sogar meistens Spaß!
Aufgrund der schnellen Veränderungszyklen, mit denen uns generative KI konfrontiert, sind kontinuierliche Weiterbildungsangebote sehr wichtig. Und wir dürfen nicht erwarten, dass Offliner in Bezug auf Techniknutzung einfach ihre Ängste oder Vorbehalte abbauen. Sie müssen gezielte Unterstützung erfahren. Wir sehen selbst bei Lehrenden in unseren deutschen Bildungseinrichtungen, dass es nicht als selbstverständlich empfunden wird, sich in diesen Bereichen fortzubilden. Die Interessierten machen es, einige warten ab, die anderen umgehen es. Nur auf die intrinsisch motivierten Autodidakten zu setzen, reicht nicht.
In Bezug auf Lehrkräfte wird deshalb häufig bemängelt, dass solche Fortbildungen nicht verpflichtend stattfinden.
Diese Diskussion führe ich häufig und sie wird in der Regel auch sehr emotional geführt. Es prallen dort immer zwei Welten aufeinander. Die eine Fraktion vertritt die These, dass verpflichtende Weiterbildungsmaßnahmen nichts bringen, weil wir Menschen nicht zwingen können, etwas zu lernen, was sie nicht lernen wollen. Aber Lehrkräfte haben eine besondere Rolle und einen Bildungsauftrag. Sie sollen junge Menschen für die Gegenwart und insbesondere für die Zukunft fit machen und bestmöglich qualifizieren. Leider habe ich in Schulen auch erlebt, dass Schüler:innen zu mir kommen und sagen: Wir müssen unseren Lehrkräften erklären, wie man diese Technik benutzt.
Im Bereich der Hochschulen wird im Übrigen häufig auf den Grundsatz "Freiheit von Forschung und Lehre" verwiesen. Die ist auch ein hehres Gut, darf aber nicht dazu führen, Zukunftskompetenzen in der Lehre auszuklammern und die Lehre nicht an veränderte Rahmenbedingungen anzupassen. Lehrende müssten nach meinem Verständnis mit gutem Beispiel – hier als selbst Lernende – vorangehen und sind auch immer Multiplikatoren.
Zurück zu der Frage: Wie bekommt man das in die breite Bevölkerung? Nach Willen der Koalitionäre, sollen "alle Bevölkerungsgruppen […] innovative und nachhaltige Angebote" für die Weiterbildung erhalten. Für Menschen, die aus der formalen Bildung heraus sind und so nicht mehr durch Medienbildung in Schulen oder das langsam eingeführte Pflichtfach Informatik erreicht werden, sollen diese Angebote durch "Start-ups, Wirtschaft, öffentlichen Bildungsträger[] und Sozialverbände[]" kommen. Finden Sie den Ansatz realistisch? Es wird jetzt nicht so laufen können, dass jeder Bürgerin und jedem Bürger ein Digitalkurs verordnet wird. Durch die Ansage "Digital Only" setzt man in der negativen Auslegung aber auf Zwang, in der etwas wohlwollenden auf das Prinzip Nudging.
Die Herausforderungen sind groß und wir müssen neue Wege finden, die Breite der Gesellschaft zu erreichen – also bis auf die kommunalen Ebenen heruntergehen. Das ist leichter gesagt als getan, denn wir müssen dabei viele Hürden überwinden: Wie erreichen wir die Menschen, die im Berufsleben sind und wie erreichen wir die große Gruppe der Offliner unter den Rentnerinnen und Rentnern? Wie werden aber auch die Menschen erreicht, die sozioökonomisch abgehängt sind? Denn das zeigt der D21-Digital-Index auch: Offliner sind sozioökonomisch eher schwächer gestellt und haben niedrigere Bildungsabschlüsse.
Um wirklich die Breite der Bevölkerung zu erreichen, muss es klare Konzepte geben und auch finanzielle Mittel, um Angebote für die vielen verschiedenen Gruppen zu machen.
Was bei dem Erreichen mehrfach benachteiligter Gruppen helfen kann, ist aber zum Beispiel wieder KI. Gibt es Sprachbarrieren, können diese nun durch KI-Simultanübersetzungen und automatische Übersetzungen von Infomaterial verringert werden. Oder KI kann komplexe Erklärungen in einfache Sprache übersetzen.
Und diese Feststellung ist schon richtig: Menschen werden natürlich durch Ansätze des "Digital Only" bzw. eine Verengung auf digitale Angebote in die Nutzung digitaler Technologien hineingetrieben. Diese Wirkung lässt sich als Pull-Effekt charakterisieren. Komme ich in Arztpraxen telefonisch nicht mehr durch oder kann ich nur noch online Termine vereinbaren? Ist Bahnfahren nur noch mit einem Mobilgerät möglich, weil Fahrkarten nur noch in Apps zu kaufen sind und ich mich bei den vielen Änderungen im Reiseverlauf nur noch online informieren kann? Wenn ich diesem Veränderungsdruck nicht nachgebe und nicht mitmache, ziehe ich mich zwangsläufig aus dieser Mobilität zurück bzw. kann nicht mehr teilhaben.
Diese Form des Zugangs zu digitalen Angeboten oder auch Qualifizierung unter Zwang wollen wir aber eigentlich nicht. Er ist zu negativ behaftet: Ich muss das jetzt, das geht nicht anders.
Ich möchte noch einen weiteren und relevanten Aspekt betonen: Viele Menschen haben Angst vor Technik. Es kostet sie Überwindung, mit technikaffinen Menschen zu sprechen, weil sie sich inkompetent fühlen und mit Fachvokabular überfordert sind.
In meinem beruflichen Leben war das immer wieder ein Thema – selbst in einem Umfeld, wo ein gewisses Grundwissen da ist. Ich war immer an einer Schnittstelle zwischen den Kunden und den eigenen IT-Expert:innen tätig. Und dort treffen verschiedene Fachsprachen und Bedürfnisse aufeinander, auch unterschiedliche Menschentypen. Ich habe mich in dieser Schnittstelle häufig wie eine Dolmetscherin gefühlt, die übersetzen musste, um das wechselseitige Verständnis und eine gemeinsame Sprache zu fördern. Das bedeutet, dass die verschiedenen Bevölkerungsgruppen ganz unterschiedlich angesprochen werden müssen. Viele Abkürzungen. Anglizismen oder Akronyme sind erklärungsbedürftig. Die "Kundenzentrierung" muss greifen, d.h. es muss eine Übersetzung in die Sprache der Adressaten und deren Denkprozesse stattfinden, damit die Info überhaupt durchdringen kann.
Aus meiner Erfahrung helfen sehr häufig einfache Bilder und auch Analogien, um Ängste abzubauen und den Austausch zu fördern – auch solche, die mir Fachkolleg:innen natürlich wegen Unterkomplexität sonst um die Ohren hauen würden. Das Motto lautet: Je einfacher, desto besser. Die Adressaten sollen auf jeden Fall verstehen: Ihr müsst kein Tecki oder Nerd sein, um teilhaben zu können.
Ganz grundsätzlich freut es mich ja, dass im Koalitionsvertrag ein Ministerium für Digitalisierung versprochen wird. Diese Form der Zentralisierung habe ich mir schon lange gewünscht. Bisher haben wir es bei dieser Querschnittsaufgabe durch die Ansiedlung in verschiedenen Ministerien mit einer Verantwortungsdiffusion zu tun. Das habe ich auch schon in Bundestagsausschüssen geäußert, zu denen ich eingeladen wurde. Eine zentrale Instanz mit Richtlinienkompetenz und Weisungsbefugnis für wesentliche Weichenstellungen ist für Digitalthemen wichtig. Die Ausgestaltung ist zwar noch nicht ganz klar, aber die Entscheidung macht zumindest Hoffnung. Durch ein eigenes Ministerium wird die Bedeutung der Digitalisierung in Deutschland sichtbar aufgewertet.
Um mal in die andere Richtung zu schauen: Wie sind Ihre Erfahrungen mit jüngeren Frauen? Auch denen wird offenbar noch häufig genug gesellschaftlich vermittelt, dass sie kein intuitives oder erlerntes Verständnis für Technik, Mathematik oder Naturwissenschaften haben können und der ganze MINT-Bereich nichts für sie sei.
Ich habe tatsächlich interessante Erfahrungen sammeln dürfen. Als Professorin für Wirtschaftsinformatik gehe ich auch in Schulen und werbe dafür. Vor einigen Jahren kamen in einem Gymnasium nach Ende meines Beitrags zwei Mädchen zu mir. Die sagten: "Das war sehr spannend und interessant, aber das dürfen wir nicht studieren." Ich habe gefragt: "Wieso?". Die Antwort lautete: "Dann bekommen wir nie einen Freund." Dieses Statement hat sich bei mir wirklich eingebrannt. Wir müssen daher an "Role Models" arbeiten, die Werbetrommel rühren und uns bei den vielen Formaten wie Zukunftstagen, Girls Days usw. beteiligen. Trotzdem entscheiden sich bis heute nur relativ wenig Frauen für IT-nahe Studiengänge. Unsere Bilanz wird schon als positiv bewertet, wenn wir bei 15 Prozent weiblichen Studienanfängerinnen in unserem Fach landen. Damit dürfen wir uns natürlich nicht zufriedengeben.
In anderen Ländern ist das teilweise nicht so. Da gibt es im Fach Informatik fast 50/50-Quoten. Das variiert weltweit wirklich sehr stark.
Auch das kann wieder mit der Zugangslücke zusammenhängen, die zwischen Männern und Frauen in Deutschland historisch gewachsen ist. Im beruflichen Kontext sind Männer mit mehr Technik in Berührung gekommen, hatten auch lange mehr Rechte als Frauen und waren auch Verwalter ihrer Güter – negativ gesagt: sie waren Gatekeeper. In meiner Generation hatte in der Regel der Vater die Fernbedienung für den Fernseher in der Hand. Das hat vielleicht nur anekdotische Relevanz, spiegelt aber die damalige Rollenverteilung in deutschen Familien während meiner Kindheit sehr anschaulich wider. Es gibt Generationen von Frauen, die nicht die Selbstverständlichkeit im Umgang mit Technik und digitalen Mitteln erlebt haben und gleichzeitig anderen Frauen, hier insbesondere ihren Töchtern, vorleben konnten. Auch heute ist es noch so, dass Männer im beruflichen Kontext – auch durch mehr Vollzeitarbeit – mehr in die Auseinandersetzung mit Digitalität gehen müssen.
Aber auch unabhängig vom Geschlecht gibt es gesamtgesellschaftlich beim Thema Digitalität eine große Zersplitterung. Die Bandbreite zwischen Offlinern und Nerds oder auch Geeks ist riesig. Die Wissensstände sind sehr unterschiedlich. Und die teils rasende technische Fortentwicklung vergrößert die bestehenden Abstände noch weiter.
Eine digitale Grundbildung in der Bevölkerung zu erreichen, ist somit ein sehr ambitioniertes Ziel. Für den Diskurs benötigen wir ein gemeinsames Grundverständnis von digitalen Technologien in unserer Gesellschaft, weil die tiefgreifenden Auswirkungen von KI zu ebenso tiefgreifenden neuen Fragestellungen führen, die insbesondere rechtliche und ethische Aspekte berühren. An diesem Diskurs sollten daher alle gesellschaftlichen Gruppen teilhaben können, denn es geht um unsere gemeinsame Zukunft in Deutschland. Mitreden können derzeit nur wenige.